GO-SH: Abwahl eines Bürgermeisters – Teil 10
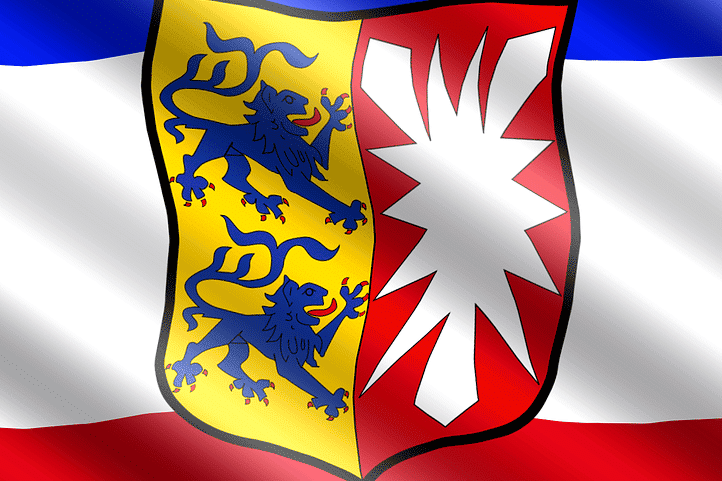
Rechtliche Bewertung zur Einstellung des Disziplinarverfahrens gegen Bürgermeister a.D. Gernot Kaser nach § 32 Abs. 1 Nr. 4 LDG SH – Eine vollständige Einordnung
Im Zusammenhang mit der Abwahl von Bürgermeister a.D. Gernot Kaser am 9. Juni 2024 wurden im politischen, medialen und verwaltungsinternen Raum eine Vielzahl an Vorwürfen erhoben. Diese reichten von unzureichender Personalführung über fehlerhafte Vergaben bis hin zu einer angeblich unzulässigen Veröffentlichung von Strafanzeigen im Internet.
Ungeachtet der medialen Inszenierung der Vorgänge liegt nunmehr eine abschließende disziplinarrechtliche Bewertung des zuständigen Landesministeriums vor: Das Disziplinarverfahren gegen Herrn Kaser wurde nach § 32 Abs. 1 Nr. 4 des Landesdisziplinargesetzes Schleswig-Holstein (LDG SH) eingestellt. Diese Vorschrift regelt die Einstellung eines Disziplinarverfahrens, wenn es aus sonstigen Gründen unzulässig ist.
Diese Veröffentlichung dient der juristischen Einordnung und Klarstellung dieser Entscheidung im Sinne der rechtsstaatlichen Transparenz.
1. Maßgeblicher rechtlicher Rahmen: Landesdisziplinargesetz Schleswig-Holstein
1.1 § 32 Abs. 1 LDG SH – Rechtsgrundlage der Einstellung
Gemäß § 32 Abs. 1 LDG SH ist ein Disziplinarverfahren u.a. einzustellen, wenn:
„[…] 4. das Disziplinarverfahren oder eine Disziplinarmaßnahme aus sonstigen Gründen unzulässig ist.“
Im Unterschied zu Einstellungen nach Nr. 1 (kein Dienstvergehen nachweisbar) oder Nr. 2 (mangelnde Erforderlichkeit einer Maßnahme) liegt hier ein formeller Unzulässigkeitsgrund vor. Dies ist der Fall, wenn keine disziplinarrechtlich relevante Pflichtverletzung überhaupt Gegenstand des Verfahrens sein kann, weil das Verhalten weder inner- noch außerdienstlich geeignet ist, die disziplinarrechtliche Integrität eines Beamten in Frage zu stellen.
Dazu die Erläuterung aus der Drucksache 15 /1767 des Schleswig-Holsteinischen Landtages, 15. Wahlperiode:
Zu § 32
Die Vorschrift bestimmt die Gründe für eine Einstellung des Disziplinarverfahrens. Das bisherige Recht regelte die Einstellungsgründe nur unvollständig. Gemäß § 25 Abs. 1 LDO wird das Verfahren nach den Vorermittlungen eingestellt, wenn durch diese ein Dienstvergehen nicht festgestellt wird oder die oder der Dienstvorgesetzte eine Disziplinarmaßnahme nicht für angezeigt oder nicht für zulässig hält. Während die erstgenannten Voraussetzungen hinreichend bestimmt sind, ist das Kriterium der Unzulässigkeit der Verhängung einer Disziplinarmaßnahme sehr vage und bedarf einer umfassenden Ausfüllung durch Rechtsprechung und Lehre, die dabei im wesentlichen auf die für das bisherige förmliche Disziplinarverfahren geltenden Einstellungsgründe des § 51 Abs. 1 und 2 LDO zurückgreifen.
In § 32 werden die Einstellungsgründe in Anlehnung an § 51 Abs. 1 und 2 LDO nunmehr konkret und zugleich abschließend geregelt. Die Gliederung des § 32 unterscheidet sich von der des § 51 Abs. 1 und 2 LDO und hebt die rein statusbezogenen Einstellungsgründe (Absatz 2) von den übrigen formellen und materiellen Einstellungsgründen, deren Bejahung eine disziplinarrechtliche Subsumtion voraussetzt (Absatz 1), ab. Diese Aufteilung erleichtert spätere Verweisungen auf die Vorschrift.
Absatz 3 normiert bezüglich der Einstellungsverfüg ung im Interesse der Beamtin oder des Beamten einen Begründungs- und Zustellungszwang.
2. Ausgangspunkt: Politisch induzierte Vorwürfe
Im Zuge eines zunehmenden politischen Konflikts zwischen dem Bürgermeister und Teilen des Rates der Stadt Wedel wurden im Jahr 2023 und Anfang 2024 zahlreiche Vorwürfe öffentlich und nichtöffentlich gegen Herrn Kaser erhoben. Diese betrafen u.a.:
-
die Beauftragung externer anwaltlicher Beratung (Kanzlei Weißleder & Ewer),
-
angeblich autoritäres Personalverhalten,
-
unterlassene oder missverständliche Kommunikation mit politischen Gremien,
-
sowie die Veröffentlichung zweier gegen ihn gerichteter Strafanzeigen auf einer privaten Internetseite im Frühjahr 2024.
Ein Teil dieser Vorgänge wurde durch das Innenministerium des Landes Schleswig-Holstein disziplinarrechtlich untersucht, nachdem am 29. Februar 2024 formell ein Disziplinarverfahren eingeleitet worden war.
3. Prüfungsergebnis des Ministeriums: Keine disziplinarrechtlich relevanten Pflichtverstöße
3.1 Beauftragung der Kanzlei Weißleder & Ewer
Die Stabsstelle Prüfdienste der Stadt Wedel prüfte die Vergabe zweier anwaltlicher Mandate durch den Bürgermeister. Ergebnis: Es lagen vergaberechtlich wirksame Vergütungsvereinbarungen vor. Die Leistungen wurden ordnungsgemäß erbracht. Zwar wurde haushaltsrechtlich eine Zurechnung zum privaten Rechtskreis des Bürgermeisters bejaht, jedoch war weder eine vorsätzliche noch eine grob fahrlässige Pflichtverletzung festzustellen.
Disziplinarrechtlich kam das Innenministerium daher zu dem Ergebnis, dass keine Anhaltspunkte für ein schuldhaftes Verhalten im Sinne des § 17 LDG SH gegeben waren.
3.2 Personalführung und Zusammenarbeit mit Gremien
Zahlreiche kritische Einschätzungen bezogen sich auf das Führungsverhalten Kasers gegenüber der Verwaltungsspitze und seine Kommunikation mit dem Rat. Das Ministerium stellte klar, dass diese Aspekte – selbst wenn kritikwürdig – nicht in den Anwendungsbereich des Disziplinarrechts fallen, solange keine spezifische Pflicht aus dem Beamtenrecht verletzt wird. Derartige Konstellationen betreffen die kommunalpolitische und verwaltungsorganisatorische Ebene, nicht die disziplinarrechtliche.
4. Die Veröffentlichung der Strafanzeigen – kein Dienstvergehen
4.1 Vorwurf und staatsanwaltschaftliches Verfahren
Am 14. Januar 2025 erhob die Staatsanwaltschaft Itzehoe Anklage gegen Herrn Kaser wegen angeblich verbotener Mitteilung über Gerichtsverhandlungen (§ 353d Nr. 3 StGB). Hintergrund war die vollständige Veröffentlichung zweier Strafanzeigen auf einer privaten Internetseite des damaligen Bürgermeisters, die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung bereits bei der Staatsanwaltschaft eingegangen waren.
4.2 Bewertung des Innenministeriums
Das Ministerium prüfte gemäß § 19 LDG, ob dieser Vorgang eine disziplinarrechtlich relevante Pflichtverletzung darstelle. Ergebnis: eine Ausdehnung des Disziplinarverfahrens wurde ausdrücklich abgelehnt. Die Veröffentlichung wurde als außerdienstliche Handlung eingestuft, da sie:
-
nicht auf dienstlicher Grundlage erfolgte,
-
keine dienstliche Information im Sinne der beamtenrechtlichen Verschwiegenheit betraf,
-
und als Ausdruck legitimer Verteidigung im politischen Raum im Zusammenhang mit einem bereits eingeleiteten Abwahlverfahren gewertet wurde.
Die Veröffentlichung diente laut Ministerium dazu, der öffentlichen politischen Instrumentalisierung der Strafanzeigen entgegenzutreten und war deshalb sachlich begründet und rechtlich zulässig.
Die disziplinarrechtliche Relevanz wurde ausdrücklich verneint:
„Herr Kaser hat mit der Veröffentlichung der Strafanzeigen im Volltext nach hier vertretener Auffassung zulässiges Verteidigungsverhalten gezeigt.“
4.3 Kein Vertrauensverlust – keine disziplinarische Maßnahme
Das Ministerium prüfte zudem die Möglichkeit einer disziplinarrechtlichen Relevanz im außerdienstlichen Bereich (§ 47 Abs. 1 BeamtStG) – etwa wegen Beeinträchtigung des Vertrauens in die Integrität der Amtsführung. Auch hier wurde festgestellt:
-
keine Rechte Dritter verletzt,
-
keine Auswirkungen auf die Unbefangenheit der Strafverfolgung,
-
keine nachhaltige Erschütterung des Ansehens der öffentlichen Verwaltung.
5. Rechtsfolge: Einstellung nach § 32 Abs. 1 Nr. 4 LDG SH
Die Konsequenz dieser umfassenden Bewertung durch das Innenministerium ist eindeutig: Das Disziplinarverfahren war mangels disziplinarrechtlich relevanter Pflichtverletzung unzulässig. Die Einstellung erfolgte daher rechtsstaatlich zwingend nach § 32 Abs. 1 Nr. 4 LDG SH.
Eine Fortführung oder gar Ausweitung des Verfahrens wäre – so das Ministerium – mit dem disziplinarrechtlichen Prüfungsmaßstab unvereinbar gewesen.
Damit gilt: Herr Kaser wurde disziplinarrechtlich vollständig entlastet.
6. Politisch-strategische Nutzung disziplinarischer Mittel – eine kritische Anmerkung
Die umfassenden Feststellungen des Innenministeriums legen nahe, dass wesentliche Teile der disziplinarischen und strafrechtlichen Verfahren aus einem politischen Kontext heraus motiviert waren, insbesondere im Rahmen des Verfahrens zur Abwahl des Bürgermeisters. Dies betrifft:
-
die strategische Verwertung vertraulicher Vorwürfe durch politische Akteure,
-
das gezielte Streuen von unbewiesenen Behauptungen im Vorfeld der Bürgerabstimmung,
-
die bewusste Verzerrung des Charakters disziplinarischer Ermittlungen in der öffentlichen Kommunikation.
Eine solche Instrumentalisierung rechtsstaatlicher Kontrollinstrumente ist verfassungsrechtlich bedenklich und läuft dem Schutzzweck des Beamtenrechts – insbesondere der Funktionsfähigkeit einer von politischen Mehrheiten unabhängigen Verwaltung – diametral zuwider.
7. Schlussfolgerung
Die rechtliche Bewertung durch das Innenministerium ist eindeutig und abschließend:
-
Gegen Gernot Kaser lag kein disziplinarrechtlich relevantes Verhalten vor.
-
Das Disziplinarverfahren war rechtlich unzulässig und wurde zu Recht eingestellt.
Diese Klarstellung dient der rechtsstaatlichen Transparenz gegenüber der Öffentlichkeit. Es muss betont werden, dass disziplinarrechtliche Verfahren nicht der politischen Auseinandersetzung dienen, sondern ausschließlich dem Schutz der Integrität des öffentlichen Dienstes. Dieser Grundsatz wurde im Fall Kaser gewahrt – durch seine Entlastung, nicht durch seine Abwahl.
Juristische Begriffserläuterungen zum Disziplinarverfahren gegen Bürgermeister a.D. Kaser
Disziplinarverfahren
Ein Disziplinarverfahren dient der Prüfung, ob ein Beamter oder eine Beamtin gegen die ihm oder ihr obliegenden Dienstpflichten verstoßen hat. Rechtsgrundlage in Schleswig-Holstein ist das Landesdisziplinargesetz (LDG SH). Es handelt sich nicht um ein Strafverfahren, sondern um ein verwaltungsinternes Verfahren zur Feststellung disziplinarrechtlicher Verantwortlichkeit.
Dienstvergehen (§ 17 LDG SH)
Ein Dienstvergehen liegt vor, wenn ein Beamter schuldhaft seine Pflichten verletzt, z. B. gegen Gesetze, Verwaltungsvorschriften oder beamtenrechtliche Grundsätze verstößt. Maßgeblich ist dabei, ob ein schuldhaftes Verhalten (vorsätzlich oder grob fahrlässig) vorliegt und ob dadurch das Vertrauen in die Integrität des Beamten beeinträchtigt wird.
Einstellung des Disziplinarverfahrens (§ 32 LDG SH)
Ein Disziplinarverfahren kann aus mehreren Gründen eingestellt werden. Relevante Varianten sind:
-
§ 32 Abs. 1 Nr. 1 LDG SH: Es liegt kein Dienstvergehen vor – der Beamte ist vollständig entlastet.
-
§ 32 Abs. 1 Nr. 2 LDG SH: Ein Verstoß liegt zwar vor, aber eine Maßnahme ist nicht angezeigt.
-
§ 32 Abs. 1 Nr. 4 LDG SH: Das Verfahren ist aus anderen Gründen unzulässig, z. B. weil das beanstandete Verhalten nicht disziplinarrechtlich relevant ist.
Im Fall Kaser wurde das Verfahren nach § 32 Abs. 1 Nr. 4 LDG eingestellt – das Verfahren hätte nicht rechtmäßig fortgeführt werden dürfen.
Innerdienstliches vs. außerdienstliches Verhalten
Ein disziplinarrechtliches Fehlverhalten muss dienstlich veranlasst oder relevant sein. Das bedeutet:
-
Innerdienstlich: Die Pflichtverletzung steht in direktem Zusammenhang mit dem Dienst.
-
Außerdienstlich: Nur wenn ein Verhalten außerhalb des Dienstes das Vertrauen in die Integrität des Beamten in besonderer Weise erschüttert, kann es disziplinarrechtlich verfolgt werden (z. B. schwere Straftaten).
Die Veröffentlichung von Strafanzeigen durch Herrn Kaser war ein außerdienstliches Verhalten, das nicht disziplinarisch relevant war und im Rahmen der Selbstverteidigung geboten war.
§ 353d StGB – Verbotene Mitteilungen über Gerichtsverhandlungen
Diese Vorschrift stellt unter bestimmten Bedingungen die Veröffentlichung von amtlichen Dokumenten eines Strafverfahrens unter Strafe, bevor sie in öffentlicher Verhandlung erörtert wurden. Sie dient dem Schutz der Unbefangenheit des Verfahrens und der betroffenen Personen.
Ob diese Vorschrift im Fall Kaser anwendbar ist, wird vom Innenministerium verneint. Das Disziplinarrecht betrifft sie nicht, da das Verhalten keinen Bezug zur Amtsausübung hatte.
Verhältnismäßigkeit und Vertrauensgrundsatz
Das Disziplinarrecht kennt den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit: Eine Maßnahme darf nur verhängt werden, wenn sie zur Wiederherstellung der Dienstpflichten erforderlich ist. Der Beamte hat außerdem Anspruch auf Vertrauen in seine gesetzestreue Amtsführung, solange kein gegenteiliger Nachweis erfolgt.
Die Einstellung des Verfahrens bedeutet daher nicht „Gnade“, sondern ist Ausdruck eines rechtsstaatlich geschützten Vertrauensverhältnisses zwischen Staat und Beamtem.
Die Einstellung des Disziplinarverfahrens gegen Herrn Bürgermeister a.D. Gernot Kaser nach § 32 Abs. 1 Nr. 4 LDG SH bedeutet ausdrücklich, dass das Verfahren aus rechtlichen Gründen nicht zulässig war – also nicht einmal in die materielle Prüfung eines Dienstvergehens eintreten durfte oder konnte.
Juristische Kernaussage:
Die disziplinarrechtliche Bewertung endet nicht „im Zweifel“, sondern eindeutig mit dem Ergebnis, dass das Verhalten Kasers rechtlich nicht disziplinarwürdig war.
Warum die Schlussfolgerung eines „Fehlverhaltens ohne Strafe“ unzulässig ist:
-
Kein Dienstvergehen festgestellt:
Bei einer Einstellung nach § 32 Abs. 1 Nr. 4 LDG wurde festgestellt, dass das Verfahren rechtlich nicht statthaft war – nicht etwa, dass ein Vergehen nicht verfolgt werden konnte, sondern dass es überhaupt keines war. -
Unzulässigkeit ≠ Bagatelle oder Milde:
Anders als bei Nr. 2 derselben Vorschrift (Vergehen liegt vor, aber Maßnahme nicht erforderlich), geht es bei Nr. 4 um einen grundsätzlichen Ausschluss disziplinarischer Bewertung, etwa mangels Dienstbezugs, fehlender disziplinarischer Relevanz oder unzuständiger Behörde. -
Missbrauch zu politischen Zwecken widerspricht dem Rechtsstaat:
Wer die Einstellung nach § 32 Abs. 1 Nr. 4 LDG als „Schuld ohne Sanktion“ darstellt, untergräbt die rechtliche Bedeutung dieser Norm, diffamiert rechtsstaatliche Verfahren und missbraucht sie zur gezielten öffentlichen Rufschädigung.
Politische Gegner, die aus der Einstellung nach § 32 Abs. 1 Nr. 4 LDG eine disziplinarische Belastung oder gar eine verdeckte Schuld ableiten, verhalten sich rechtswidrig, irreführend und ehrverletzend. Eine solche Interpretation stellt eine gezielte Umdeutung rechtlicher Begriffe dar und erfüllt – je nach Kontext – unter Umständen den Tatbestand der üblen Nachrede (§ 186 StGB) oder der Verleumdung (§ 187 StGB).
Die Entscheidung des Schleswig-Holsteinischen Verwaltungsgerichts vom 19. November 2024 im Fall Ratzeburg (Az. 6 A 10014/21) weist in zentralen Punkten parallele Strukturen und rechtliche Relevanz zum Fall von Bürgermeister a.D. Gernot Kaser in Wedel auf.
Beide Fälle betreffen politisch initiierte Abwahlverfahren gegen amtierende hauptamtliche Bürgermeister, begleitet von disziplinar- und strafrechtlichen Vorwürfen sowie öffentlicher Kommunikation, die das Sachlichkeitsgebot verletzt haben dürfte.
1. Ausgangslage: Politische Konflikte als Grundlage der Abwahl
| Fall Kaser (Wedel) | Fall Ratzeburg |
|---|---|
| Kommunalpolitisch motivierter Abwahlbeschluss gegen den Bürgermeister, gestützt auf vage Vertrauensbehauptungen, angeblich gestörte Kommunikation mit Gremien und Führungspersonal. | Abwahl durch Ratsbeschluss mit Verweis auf angeblich fehlende Kooperationsfähigkeit, zerrüttete Beziehungen zu Feuerwehr, Schulleitung, Verwaltung – ohne konkrete Nachweise. |
Beide Verfahren waren nicht durch objektive oder gerichtlich festgestellte Pflichtverletzungen motiviert, sondern dienten der politischen Auseinandersetzung mit einem unbequemen Amtsinhaber.
2. Öffentliche Kommunikation: Grenzüberschreitung des Sachlichkeitsgebots
In beiden Fällen kam es zu massiver öffentlicher Beeinflussung der Abstimmungsberechtigten durch einseitige, diffamierende Darstellungen:
| Wedel (Kaser) | Ratzeburg |
|---|---|
| Öffentliche Erwähnung eines laufenden Disziplinarverfahrens und Veröffentlichung von Strafanzeigen gegen Kaser im Zusammenhang mit dem Abwahlverfahren. | Verwendung von Begriffen wie „Trümmerfeld“, „fehlende Glaubwürdigkeit“, Verweis auf Disziplinar- und Strafverfahren, pauschale Unterstellungen in amtlich wirkenden Flyern. |
→ Das Verwaltungsgericht Schleswig-Holstein stellte im Fall Ratzeburg fest, dass die Stadtvertretung das Sachlichkeitsgebot grob verletzt habe, insbesondere durch eine eindeutige, unzulässige Abstimmungsempfehlung und durch nicht belegte Vorwürfe mit stark diskreditierender Wirkung.
3. Disziplinar- und Strafvorwürfe als politische Werkzeuge
In beiden Fällen wurde versucht, disziplinarrechtliche Verfahren und Strafanzeigen als Legitimationsgrundlage für die Abwahl zu instrumentalisieren:
| Wedel (Kaser) | Ratzeburg |
|---|---|
| Disziplinarverfahren wurde eingeleitet, jedoch mangels disziplinarischer Relevanz nach § 32 Abs. 1 Nr. 4 LDG eingestellt. Keine strafrechtliche Verurteilung. | Es wurde öffentlich auf ein laufendes Disziplinarverfahren und angebliche Ermittlungen hingewiesen. Das Gericht stellte fest: keine Belege für die Vorwürfe, keine rechtliche Grundlage. |
→ Beide Fälle zeigen, wie nicht abgeschlossene oder unbegründete Verfahren öffentlich als Tatsache dargestellt wurden, um das politische Ziel – die Abwahl – zu stützen.
4. Rechtswidrigkeit der Abwahl: Im Fall Ratzeburg gerichtlich festgestellt
Im Fall Ratzeburg hat das Verwaltungsgericht die Abwahl wegen Verstoßes gegen das Sachlichkeitsgebot für rechtswidrig erklärt:
„Das Informationsschreiben […] enthält eine unzulässige Abstimmungsempfehlung […], überschreitet die Grenzen des Sachlichkeitsgebots und ist dem Anschein nach eine amtliche Äußerung.“
Im Fall Kaser liegt bislang keine gerichtliche Entscheidung zur Abwahl vor, aber auch hier wurden Beeinflussungen dokumentiert, u. a. durch:
-
politische Verbreitung von Disziplinarvorwürfen,
-
gezielte mediale Kampagnen,
-
Verwendung der Strafanzeigen im Kontext der Abwahl.
→ Diese Aspekte legen nahe, dass auch im Fall Kaser Verstöße gegen demokratische Abstimmungsgrundsätze vorliegen könnten – ähnlich wie im Fall Ratzeburg.
5. Rehabilitationsinteresse und Stigmatisierung
Beide Bürgermeister machten nach ihrer Abwahl geltend, dass durch die öffentliche Darstellung ein nachhaltiger Reputationsschaden entstanden sei. Das Verwaltungsgericht stellte im Fall Ratzeburg fest:
„Die Abwahl wirkte in ihrer Außenwirkung wie eine Bloßstellung […] und bewirkte eine Stigmatisierung.“
Gleiches gilt für Herrn Kaser, gegen den:
-
keine disziplinarrechtliche Maßnahme verhängt wurde,
-
keine strafrechtliche Verurteilung vorliegt,
-
aber gleichwohl öffentlich der Eindruck einer Schuld erzeugt wurde.
Der Fall Kaser im Licht des Falls Ratzeburg
Der Fall Ratzeburg bildet eine juristisch anerkannte Parallele, die den Umgang mit dem Fall Kaser als rechtsstaatlich fragwürdig erscheinen lässt. Beide Fälle zeigen:
-
wie kommunalpolitische Mehrheiten rechtliche Instrumente zur Abwahl eines Amtsinhabers politisch missbrauchen können,
-
wie unzutreffende oder unbelegte Vorwürfe öffentlich wirksam verbreitet werden,
-
und wie sich rechtlich einwandfrei entlastete Personen einem irreversiblen Rufschaden gegenübersehen.
In Ratzeburg konnte die Rechtswidrigkeit nachgewiesen werden – im Fall Wedel wäre eine vergleichbare juristische Aufarbeitung dringend geboten, um die Integrität demokratischer Verfahren zu schützen.
