Besserer Schutz für Designs
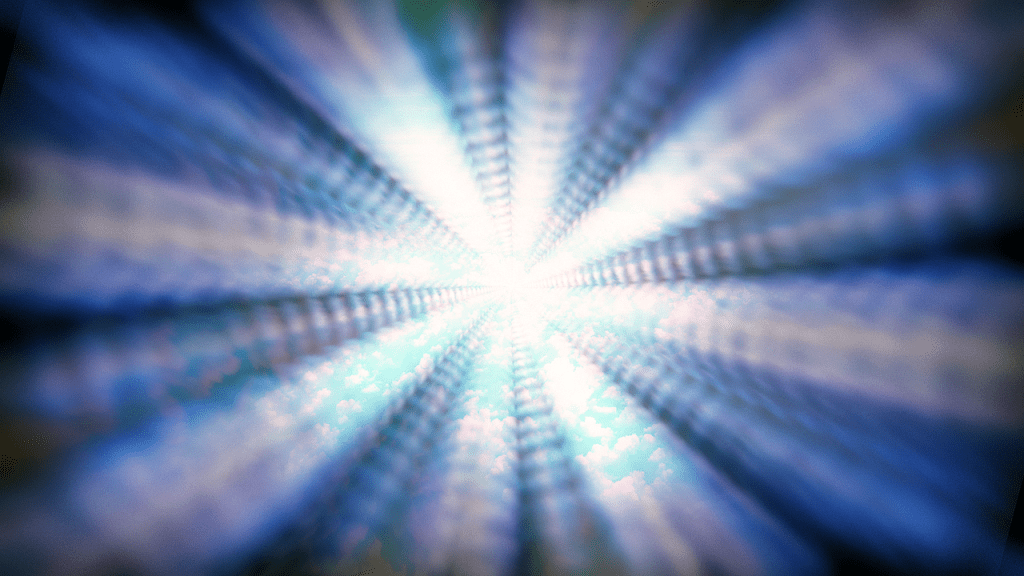
Gesetzentwurfs zur Modernisierung des Designrechts (Umsetzung der Richtlinie (EU) 2024/2823)
Mit Datum vom 14. November 2025 hat das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz (BMJV) den Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2024/2823 über den rechtlichen Schutz von Designs vorgelegt. Der Entwurf verfolgt eine vollständige 1:1-Umsetzung der europäischen Vorgaben und verbindet diese mit einer Modernisierung und Entbürokratisierung der nationalen Design- und Markenverfahren. Die Reform stellt einen zentralen Schritt dar, um den technologischen Entwicklungen – insbesondere digitaler Gestaltung – gerecht zu werden und zugleich die Rechtsdurchsetzung gegenüber Designpiraterie, auch im Kontext des 3D-Drucks, zu stärken.
1. Rechtsrahmen: Hintergrund und Zielsetzung der Richtlinie (EU) 2024/2823
Die Richtlinie (EU) 2024/2823 vom 23. Oktober 2024 reformiert das unionsweite Designrecht und harmonisiert insbesondere die materiellen Schutzvoraussetzungen, Nutzungsausnahmen und Durchsetzungsmechanismen. Sie ergänzt die Verordnung (EG) Nr. 6/2002 über das Gemeinschaftsgeschmacksmuster.
Zentrale unionsrechtliche Ziele sind:
-
Stärkung des Binnenmarktes durch Harmonisierung des Ersatzteilmarktes (Reparaturklausel),
-
Anpassung des Designschutzes an technologische und digitale Entwicklungen,
-
Verbesserung der Durchsetzbarkeit gegenüber grenzüberschreitender Designpiraterie,
-
Abbau nicht genutzter oder überholter Verfahrensstrukturen.
Der deutsche Gesetzentwurf orientiert sich an diesen Vorgaben und enthält keine nationalen Verschärfungen.
2. Anerkennung neuer Designformen und Erleichterung digitaler Anmeldungen
2.1 Klarstellung: Bewegung als designrelevantes Merkmal
Bereits nach geltendem § 1 Nr. 1 DesignG konnten digitale Gestaltungen geschützt werden, sofern sie als Erscheinungsform eines Erzeugnisses wahrnehmbar sind. Der Gesetzentwurf präzisiert nun, dass Bewegungsabläufe, Transitions und Animationen ausdrücklich schutzfähig sind. Dies entspricht Art. 3 Abs. 3 der Richtlinie.
Rechtlich relevant wird damit insbesondere:
-
Schutz animierter Benutzeroberflächen (UI/UX),
-
Schutz dynamischer Logos,
-
Schutz digitaler Anzeigen in Fahrzeugen, Haushaltsgeräten oder Wearables.
2.2 Neue Anmeldeform: Video
Erstmals wird die Anmeldung als Videodatei ermöglicht. Dies beseitigt die bislang bestehende Diskrepanz zwischen der tatsächlichen Erscheinungsform animierter Designs und der statischen bildlichen Darstellung im Register.
3. Verstärkter Schutz eingetragener Designs
3.1 Verbot vorbereitender Handlungen für designverletzende 3D-Drucke
Die bereits heute bestehende Schutzlücke im Bereich 3D-Druck wird geschlossen. Künftig gelten auch Vorbereitungshandlungen – insbesondere das Bereitstellen, Veräußern oder Hochladen von CAD-Dateien – als designverletzend, wenn diese objektiv auf die Herstellung eines rechtsverletzenden Erzeugnisses gerichtet sind.
Dies schafft erstmals eine klare Rechtsgrundlage gegen:
-
CAD-Datenbanken,
-
Tauschbörsen für Ersatzteilmodelle,
-
gewerbliche Anbieter von 3D-Replikationsdienstleistungen.
3.2 Durchfuhrverbot für designverletzende Produkte
Nach dem Vorbild der Zollverordnung stärkt der Entwurf die Durchsetzungsmöglichkeiten im Transit:
-
Bereits die bloße Durchfuhr designverletzender Erzeugnisse durch EU-Gebiet stellt eine Rechtsverletzung dar.
-
Der Designinhaber kann im Transitstaat gegen die Ware vorgehen.
Damit sollen internationale Piraterieketten wirksam unterbrochen werden.
3.3 Neue Kennzeichnungsmöglichkeit
Zur Stärkung der Präventionswirkung wird ein freiwilliges Kennzeichnungssystem eingeführt. Das neue Symbol Ⓓ soll analog zum Copyright-Hinweis den bestehenden Schutz verdeutlichen.
Juristische Wirkung:
-
kein eigenes Schutzrecht,
-
keine konstitutive Wirkung,
-
aber erheblich verbesserte Beweisfunktion im Rahmen der Täter- und Teilnehmerhaftung (§§ 830 ff. BGB) sowie bei Verschuldensfragen.
3.4 Ausnahmen zugunsten der Meinungs- und Kommunikationsfreiheit
Klar bestätigt wird die Zulässigkeit der Nutzung zu:
-
Kommentierung,
-
Kritik,
-
Parodie.
Damit wird der unionsrechtlich gebotene Ausgleich zwischen Ausschließlichkeitsrecht und öffentlichem Diskurs umgesetzt (Art. 20 der Richtlinie).
4. Die Reparaturklausel – Liberalisierung des formgebundenen Ersatzteilmarktes ab 2032
Bereits § 40a DesignG (eingeführt 2020) enthielt eine nationale Reparaturklausel. Diese wird nun an die unionsweit geltende Übergangsregel angepasst. Ab 2032 gilt europaweit:
-
Formgebundene Ersatzteile (z.B. Stoßfänger, Kotflügel, Spiegelgehäuse) dürfen zum Zweck der Reparatur frei vertrieben und eingebaut werden.
-
Der Originalhersteller kann sich zur Blockade des Aftermarkets nicht mehr auf Designrechte berufen.
-
Ziel ist ein transparenter, wettbewerbsintensiverer Markt.
Ökonomische Auswirkungen:
-
Senkung der Reparaturkosten,
-
Förderung unabhängiger Werkstätten,
-
Minderung von Marktmachtpositionen großer Automobilhersteller.
Für Deutschland, das die Reparaturklausel bereits kennt, beschränkt sich die Reform im Wesentlichen auf eine Anpassung der Übergangsfristen.
5. Bürokratierückbau und Verfahrensmodernisierung
Der Entwurf sieht mehrere verfahrensrechtliche Änderungen vor:
5.1 Streichung obsoleter Verfahren
Nicht genutzte oder missverständliche Instrumente – etwa die Möglichkeit der „teilweisen Aufrechterhaltung“ eines Designs – entfallen. Dies dient der Verfahrensvereinfachung.
5.2 Beschränkung komplizierter Rückverweisungen
Das Bundespatentgericht (BPatG) erhält die Kompetenz, Beschwerdeverfahren durch eigenen Beschluss einzustellen, ohne zwingend an das DPMA zurückverweisen zu müssen.
Effekt:
-
Verfahrensbeschleunigung,
-
Entlastung des DPMA,
-
Verringerung von Doppelprüfungen.
5.3 Digitalisierung der Anmeldung
Neben der Einführung von Videoformaten sollen:
-
elektronische Kommunikation ausgebaut,
-
Formularverfahren gestrafft,
-
Fristen und Formerfordernisse harmonisiert werden.
6. Bewertung und Einordnung
Für Unternehmen und Designer:
-
erleichterte Anmeldung innovativer und digitaler Gestaltung,
-
verbesserte Rechtsdurchsetzung gegenüber Plattformanbietern,
-
größere Rechtssicherheit.
Für Verbraucher:
-
geringere Reparaturkosten ab 2032,
-
stärkere Marktöffnung.
Für Behörden und Gerichte:
-
effizientere Beschwerdeverfahren,
-
weniger unnötige Verfahrensschritte.
