Disziplinarmaßnahmen nach § 25 SchulG SH – Rechtliche Grundlagen, Instrumente und Zielsetzung
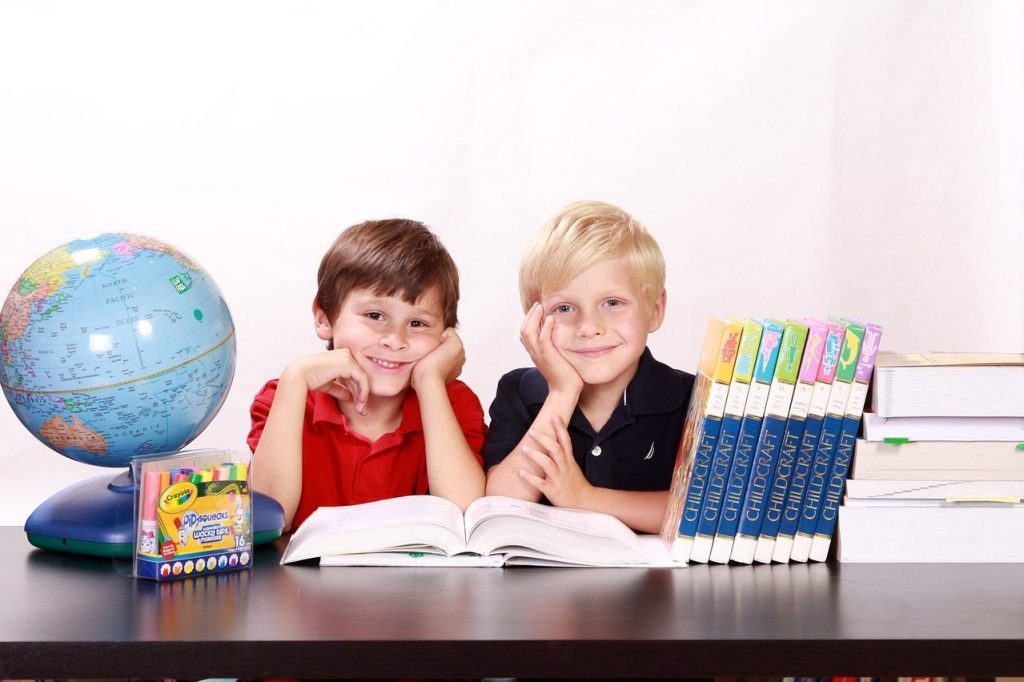
Der § 25 Schulgesetz Schleswig-Holstein (SchulG SH) normiert ein abgestuftes System pädagogischer und disziplinarischer Maßnahmen bei Konflikten mit oder zwischen Schülerinnen und Schülern. Ziel ist es, die schulische Ordnung zu sichern, den Bildungsauftrag zu erfüllen (§ 4 SchulG SH) und zugleich den Erziehungscharakter schulischer Maßnahmen zu wahren.
Systematik des § 25 SchulG SH
Die Vorschrift gliedert sich in drei Stufen:
- Pädagogische Maßnahmen (§ 25 Abs. 1 SchulG SH)
- Ordnungsmaßnahmen (§ 25 Abs. 2–6 SchulG SH)
- Eilmaßnahmen (§ 25 Abs. 7 SchulG SH)
Diese Dreiteilung entspricht dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit und dem erzieherischen Auftrag der Schule.
Pädagogische Maßnahmen (Abs. 1)
Pädagogische Maßnahmen stehen im Mittelpunkt schulischer Konfliktbearbeitung und genießen Vorrang vor repressiven Eingriffen. Sie setzen auf Partizipation, Reflexion und positive Verhaltenssteuerung:
- Formen: erzieherisches Gespräch, Ermahnung, Missbilligung, Wiedergutmachung, Nachholen von versäumtem Unterricht, temporäre Wegnahme störender Gegenstände.
- Ziel: Einsichtsförderung und Stärkung der sozialen Kompetenz durch niedrigschwellige, dialogorientierte Maßnahmen.
Diese Maßnahmen bedürfen keiner formellen Verfahrensregeln und sind der pädagogischen Gestaltungsfreiheit zugeordnet.
Ordnungsmaßnahmen (Abs. 2–6)
Wenn pädagogische Maßnahmen nicht ausreichen oder bestimmte Schwellen überschritten sind (z. B. Gewaltanwendung, beharrliche Regelverstöße), kommen Ordnungsmaßnahmen in Betracht. Voraussetzungen:
- Zweckbindung: Sicherstellung schulischer Ordnung, Befolgung notwendiger Anordnungen, Reaktion auf Gewalt.
- Typenkatalog (Abs. 3 Satz 1):
- Schriftlicher Verweis
- Ausschluss von außerunterrichtlichen Schulveranstaltungen
- Ausschluss in einem Fach (max. 3 Wochen)
- Vorübergehende Zuweisung in eine andere Klasse (max. 4 Wochen)
- Ausschluss vom Unterricht (max. 3 Wochen)
- Versetzung in eine andere Klasse
- Überweisung an eine andere Schule (mit gleichem Bildungsabschluss)
- Besonderheiten:
-
- Die Maßnahmen der Stufen 4–7 setzen „schweres oder wiederholtes Fehlverhalten“ voraus.
- Körperliche oder entwürdigende Maßnahmen sind verboten.
- Maßnahmen müssen pädagogisch begleitet werden.
- Verfahren:
-
- Anhörungspflicht (Abs. 4): Schüler/in und Eltern (bei Minderjährigen) sind anzuhören.
- Verhältnismäßigkeitsgrundsatz: Die Maßnahme muss geeignet, erforderlich und angemessen sein.
- Rechtsmittel (Abs. 8): Widerspruch und Klage haben keine aufschiebende Wirkung – § 80 Abs. 2 Nr. 4 VwGO findet Anwendung.
- Behördliche Beteiligung: Die Maßnahme Nr. 7 („Überweisung“) bedarf der Entscheidung der Schulaufsichtsbehörde (Abs. 6).
Dringende Eilmaßnahmen (Abs. 7)
Wenn durch das Verhalten einer Schülerin oder eines Schülers der Unterrichtsbetrieb akut gefährdet ist, kann die Schulleitung vorläufige Maßnahmen ergreifen:
- Ausschluss vom Unterricht für max. 10 Tage.
- Sicherung des Schulbetriebs bei Gefahr im Verzug.
- Keine endgültige Entscheidung – die ordentliche Maßnahme ist unverzüglich nachzuholen.
Diese Regelung entspricht einer Art einstweiliger Anordnung im Schulverhältnis.
Hintergrund und Zielrichtung
Die Regelung in § 25 SchulG SH beruht auf einem integrativen Erziehungskonzept:
- Primat des Pädagogischen: Konflikte sollen vorrangig durch Gespräch und Einbindung gelöst werden.
- Schutz der Schulgemeinschaft: Die Grenzen der individuellen Freiheit enden dort, wo das schulische Miteinander gefährdet wird.
- Wahrung der Grundrechte: Eingriffe in das Schulverhältnis berühren das allgemeine Persönlichkeitsrecht (Art. 2 Abs. 1 GG), die Schulpflicht (Art. 7 GG) und das Elternrecht (Art. 6 GG) – sie bedürfen klarer gesetzlicher Grundlagen und rechtstaatlicher Verfahren.
- Gewaltprävention: Insbesondere Gewaltanwendung oder deren Androhung (Abs. 2 Nr. 3) begründet ein repressives Einschreiten.
Bewertung
Die differenzierte Regelung des § 25 SchulG SH zeigt den Versuch, die Schule nicht nur als Lernort, sondern auch als soziales System zu begreifen, in dem Ordnung und Teilhabe zusammen gedacht werden. Die Einbindung pädagogischer, sozialpädagogischer und gegebenenfalls auch externer Fachkräfte entspricht modernen Vorstellungen schulischer Konfliktbearbeitung. Jedoch ist auf eine korrekte rechtliche Dokumentation, Beteiligung der Eltern und eine transparente Kommunikation der Maßnahmen großer Wert zu legen, um rechtsstaatlichen Anforderungen gerecht zu werden und Konflikte nicht zu eskalieren.
Mobbing an Schulen
1. Juristische Einordnung von Mobbing im Schulrecht
Mobbing ist im Schulgesetz nicht ausdrücklich definiert, kann aber je nach Ausprägung als Verstoß gegen schulische Verhaltensnormen (§ 25 SchulG SH) und als Verletzung der Persönlichkeitsrechte anderer Schüler:innen gewertet werden. Formen können sein:
-
psychische Gewalt (Ausgrenzung, Gerüchte, Demütigung)
-
körperliche Gewalt
-
digitale Angriffe (Cybermobbing)
→ Solche Handlungen können Anlass für Ordnungsmaßnahmen nach § 25 Abs. 2–3 SchulG SH sein, insbesondere bei wiederholtem oder schwerem Fehlverhalten.
2. Verantwortung der Schule
a. Schutzpflicht der Schule
Gemäß § 4 Abs. 11 SchulG SH hat die Schule ein Präventions- und Interventionskonzept zu entwickeln und umzusetzen, um die seelische und körperliche Unversehrtheit der Schüler zu schützen. Hieraus ergibt sich eine aktive Handlungspflicht:
-
Frühzeitige Identifikation von Mobbingstrukturen
-
Einleitung pädagogischer und gegebenenfalls ordnungsrechtlicher Maßnahmen
-
Einbeziehung von Schulsozialarbeit, Schulpsychologie und ggf. Jugendhilfe
-
Dokumentation und Maßnahmenplanung
Kommt die Schule diesen Pflichten nicht nach, kann im Einzelfall sogar eine amtspflichtwidrige Unterlassung (vgl. § 839 BGB i.V.m. Art. 34 GG) in Betracht gezogen werden.
b. Verhältnismäßigkeit und Differenzierung
Lehrkräfte und Schulleitung haben auch die Verhaltenskontexte sorgfältig zu analysieren: Wer ist primär Täter? Wer reagiert ggf. nur auf andauerndes Fehlverhalten anderer?
3. Verantwortung der Eltern
Eltern haben nach § 4 Abs. 9 SchulG SH i.V.m. Art. 6 GG das Erziehungsrecht, das sie aber in Kooperation mit der Schule ausüben. Daraus ergibt sich:
-
Mitverantwortung bei der Konfliktlösung (z. B. Teilnahme an Gesprächen)
-
Pflicht zur Erziehung zur Gewaltfreiheit und Toleranz
-
Unterstützung pädagogischer Maßnahmen der Schule
Wenn Eltern ihren Erziehungsaufgaben wiederholt nicht nachkommen, kann dies in extremen Fällen auch aufsichtsrechtliche Maßnahmen nach dem Kinderschutzrecht auslösen (vgl. § 1666 BGB).
4. Täter-Opfer-Dynamik – Komplexe Abgrenzung
Mobbing ist kein statisches Täter-Opfer-Modell. Insbesondere wenn eine Gruppe von Schülern sich scheinbar „wehrt“ gegen das Fehlverhalten eines Einzelnen, ist Vorsicht geboten:
a. Rechtfertigung durch „Selbstschutz“?
Ein aktives, systematisches Ausgrenzen oder Demütigen eines „problematischen“ Mitschülers ist nicht durch dessen Fehlverhalten gerechtfertigt. Auch hier bleibt die Gruppe Täter:
Grundsatz: Eine Regelverletzung darf nicht durch eine andere Regelverletzung beantwortet werden.
b. Mehrdimensionale Täter-Opfer-Konstellationen
In der Praxis liegt oft ein Wechselspiel vor:
-
Schüler A provoziert oder missachtet Regeln (z. B. durch aggressives, aufdringliches Verhalten).
-
Gruppe B reagiert mit sozialem Ausschluss, Spott, Häme, ggf. Gewalt.
→ Hier müssen alle Seiten analysiert und einbezogen werden. Die Schule hat die Pflicht, nicht nur das Verhalten des ursprünglich auffälligen Schülers, sondern auch die eskalative Dynamik der Gruppe zu bewerten.
5. Was folgt daraus für Maßnahmen gemäß § 25 SchulG SH?
a. Pädagogische Maßnahmen (Abs. 1):
-
Klärungsgespräche
-
Einbindung aller Beteiligten (inkl. Eltern, Schulsozialarbeit)
-
Empathietraining / Klassenprojekte
-
Verstärkte Aufsicht & Beobachtung
b. Ordnungsmaßnahmen (Abs. 2–3):
-
Nur bei wiederholtem oder gravierendem Fehlverhalten
-
Mögliche Sanktionen gegen beide Seiten, wenn Eskalation auf Gegenseitigkeit beruht
c. Verfahrensrechtlich:
-
Anhörung aller Beteiligten zwingend
-
Verhältnismäßigkeit prüfen
-
Maßnahmen dokumentieren und begründen
-
Schutzmaßnahmen ggf. auch für „Täter“, wenn diese selbst unter sozialen Belastungen stehen
Mobbing erfordert eine sorgfältige pädagogisch-juristische Einzelfallprüfung. Weder die Täter- noch die Opferrolle ist pauschal zuzuweisen, vor allem dann nicht, wenn Konflikte auf gegenseitigem Fehlverhalten beruhen. Die Schule hat die Pflicht zur Intervention und Prävention, Eltern tragen eine Mitverantwortung, und disziplinarische Maßnahmen müssen verhältnismäßig und differenziert erfolgen.
Mögliche Reaktionsmatrix der Schule bei Mobbing und sozialen Konflikten
| Stufe | Vorfall/Anzeichen | Schulische Maßnahmen | Rechtsgrundlage | Bemerkungen / Beteiligte |
|---|---|---|---|---|
| 1. Prävention | Keine konkreten Vorfälle, aber Hinweise auf Cliquenbildung, Ausgrenzung oder soziale Spannungen | – Soziales Lernen im Unterricht- Projekttage „Gegen Mobbing“- Schulregeln thematisieren- Klassenrat / Mediation | § 4 Abs. 11 SchulG SH | Präventionskonzept verpflichtend; Schulkonferenz kann Rahmen setzen |
| 2. Erste Anzeichen | Erste Hinweise durch Schüler:innen, Eltern oder Lehrkräfte auf Ausgrenzung, Spott, Einschüchterung | – Einzelgespräche- Erzieherisches Gespräch mit Beteiligten- Gespräch mit Klassenleitung und ggf. Schulsozialarbeit- Dokumentation im Klassenbuch | § 25 Abs. 1 SchulG SH | Fokus auf Deeskalation und frühzeitiges Eingreifen |
| 3. Wiederholtes Fehlverhalten | Gleichartiges Verhalten tritt erneut auf, trotz pädagogischer Ansprache | – Schriftliche Missbilligung- Klassenkonferenz- Aufgaben zur Reflexion des Verhaltens- Elterngespräch unter Beteiligung der Schulleitung | § 25 Abs. 1, ggf. Einleitung Abs. 2 SchulG SH | Beteiligung der Schulsozialarbeit und ggf. Beratungsstelle empfohlen |
| 4. Mobbingstrukturen (nachweisbar) | Wiederholte, zielgerichtete Herabsetzung, Demütigung, psychischer Druck durch Gruppe oder Einzelne | – Schriftlicher Verweis- Ausschluss von Klassenfahrten etc.- Umsetzung in Parallelklasse (Abs. 3 Nr. 4)- Schutzmaßnahmen für Opfer (z. B. Aufsicht, Sitzordnung, Betreuung) | § 25 Abs. 3 Nr. 1–4 SchulG SH | Täter-Opfer-Dynamik genau analysieren; Schutzauftrag für Betroffene beachten (§ 4 Abs. 11 SchulG SH) |
| 5. Eskalation / Gewalt | Körperliche Übergriffe, Cybermobbing, Aufruf zur Gewalt, massive Einschüchterung | – Ausschluss vom Unterricht- Überweisung in andere Klasse oder Schule (Nr. 5–7)- ggf. sofortiger Ausschluss durch Schulleitung (Abs. 7)- Anzeige bei Polizei bei Strafrechtsrelevanz | § 25 Abs. 3 Nr. 5–7 und Abs. 7 SchulG SH | Schulaufsicht einbeziehen; Jugendamt und ggf. Polizei benachrichtigen |
| 6. Nachsorge | Nach Intervention sind Maßnahmen abgeschlossen, Gefahr besteht nicht mehr fort | – Pädagogische Begleitung- Reintegration- Gesprächsangebote- Kontrolle des sozialen Klimas | § 25 Abs. 1 SchulG SH (weiterhin) | Rückfallgefahr kontrollieren; Stärkung des sozialen Miteinanders |
Hinweise zur Umsetzung
-
Dokumentation: Jede Maßnahme ist zu dokumentieren – zur Nachvollziehbarkeit und bei ggf. rechtlicher Überprüfung (z. B. Klage nach § 80 V VwGO gegen eine Ordnungsmaßnahme).
-
Verhältnismäßigkeit: Jede Maßnahme muss dem Verhalten angemessen sein – insbesondere bei „Gegenseitigkeit“ von Angriff und Verteidigung.
-
Kindeswohl: Nach § 4 Abs. 11 SchulG SH ist stets zu prüfen, ob eine Kindeswohlgefährdung vorliegt. Dann: Information an das Jugendamt (§ 4 KKG).
Maßstab des § 25 SchulG SH auch in der Grundschule anwendbar
Der § 25 SchulG SH unterscheidet nicht nach Schularten oder Altersgruppen – er gilt für alle öffentlichen Schulen. Auch für Grundschulen sind also pädagogische und ordnungsrechtliche Maßnahmen bei Fehlverhalten vorgesehen. Maßgeblich ist jedoch:
-
der Reifegrad der Kinder
-
der Erziehungsauftrag (§ 4 SchulG SH)
-
die Verhältnismäßigkeit der Maßnahme im Einzelfall
Bei Kindern unter 14 Jahren (also unterhalb der strafrechtlichen Verantwortlichkeit) ist besonders zu prüfen, ob das Kind das Unrecht der Handlung erkennen konnte und in welchem Maß ein schulisches Fehlverhalten vorliegt.
Entwicklungspsychologische Besonderheiten im Alter 9–10 Jahre
In dieser Altersphase (Übergang von der mittleren Kindheit zur Präadoleszenz):
-
Identitätsfindung und Gruppenzugehörigkeit spielen eine große Rolle.
-
Kinder beginnen, soziale Strukturen zu erkennen, können aber die Folgen ihres Tuns nur eingeschränkt reflektieren.
-
Selbstschutz wird oft mit Angriff verwechselt, emotionale Impulskontrolle ist noch nicht gefestigt.
Das bedeutet: Was wie gezieltes Mobbing aussieht, kann auch eine kindliche Überforderung mit einem dominanten oder auffälligen Mitschüler sein.
Bedeutung für den schulischen Umgang mit Mobbing
a. Täter-Opfer-Zuschreibungen sind zurückhaltend zu verwenden
Ein Kind, das sich „wehrt“, ist nicht automatisch „Täter“, aber auch kein „Rechtfertigungsopfer“.
Differenzierte Analyse erforderlich: Welche Dynamiken bestehen? Welche Rollen wechseln situativ? Gab es Initiatoren, Mitläufer, Unterstützer?
b. Maßnahmen aus § 25 Abs. 1 SchulG SH haben absoluten Vorrang
Für diese Altersgruppe ist auf folgende Punkte zu achten:
| Zulässige Reaktionen (Abs. 1) | Unzulässige Reaktionen |
|---|---|
| Erzieherisches Gespräch | Strafende Ausgrenzung |
| Einbezug der Eltern | Öffentliche Bloßstellung |
| Reflexionsaufgaben | Kollektivstrafen |
| Soziales Training | Beschämung vor der Klasse |
→ Körperliche Strafen, entwürdigende Maßnahmen oder Eskalation über Ordnungsstufen hinaus sind ausgeschlossen und unzulässig (§ 25 Abs. 3 Satz 3).
Schutzpflicht der Schule bei Anzeichen von Mobbing (§ 4 Abs. 11 SchulG SH)
Die Schule hat eine aktive Schutzpflicht. Wenn sich Kinder gegen einen auffälligen Mitschüler wehren, ist dies ein Indikator für strukturelles Versagen der sozialen Steuerung in der Klasse. Die Schule muss:
-
das Klassenklima untersuchen
-
pädagogische Angebote verstärken
-
die betroffenen Schüler begleiten, nicht sanktionieren
Ein „mobbendes“ Kind mit Regelverletzungen muss nicht schulrechtlich sanktioniert, sondern sozial gestützt werden.
Verantwortung der Eltern
In dieser Altersgruppe ist die Zusammenarbeit mit Eltern zwingend und essenziell:
-
Eltern der „Mobber“: zur Erziehung anhalten, Reflexion fördern
-
Eltern des betroffenen Kindes: Schutz- und Unterstützungsmaßnahmen erklären
-
Gesamtelternschaft: Klassenklima klären, ggf. thematischer Elternabend
Die Schule ist hier Vermittlerin – keine Strafinstanz. Die Eltern sind nach § 4 Abs. 9 SchulG SH ausdrücklich in die Erziehungspartnerschaft eingebunden.
Reaktionsmatrix z.B. für die 4. Grundschulklasse (angepasst)
| Stufe | Maßnahme | Zielsetzung |
|---|---|---|
| 1. Beobachtung | Gespräche, Dokumentation, Aufsicht erhöhen | Früherkennung |
| 2. Pädagogische Intervention | Konfliktgespräch, Rollenspiele, Sozialtraining | Verhaltensreflexion |
| 3. Klassenebene | Klassenrat, externe Moderation (Schulsozialarbeit) | Gemeinschaft stärken |
| 4. Elternarbeit | Einbezug aller Erziehungsberechtigten | Gemeinsame Verantwortung |
| 5. Einzelfallklärung | Differenzierte Analyse von Eskalationen | Täter-Opfer-Konstellation herausarbeiten |
| 6. Schutzmaßnahmen | Einzelbetreuung, Rückzugsräume, ggf. temporäre Trennung | Schutz des Kindeswohls |
Bei Grundschulkindern z.B. im Alter von 9 bis 10 Jahren stehen pädagogische, nicht punitive Maßnahmen im Vordergrund. Das Schulgesetz ermöglicht Maßnahmen, verpflichtet aber auch zur besonderen Berücksichtigung des Kindeswohls und der Persönlichkeitsentwicklung (§ 4 Abs. 1–3 SchulG SH). Täter-Opfer-Zuschreibungen dürfen in diesem Alter nicht vorschnell und nicht schematisch erfolgen. Schulen sind gehalten, ein konfliktsensibles, strukturierendes und kooperatives Umfeld zu schaffen – Mobbing ist immer ein Indikator für ein gestörtes Klassenklima, nicht nur für individuelles Fehlverhalten.
