Informationsfreiheitsgesetz – was ist das?
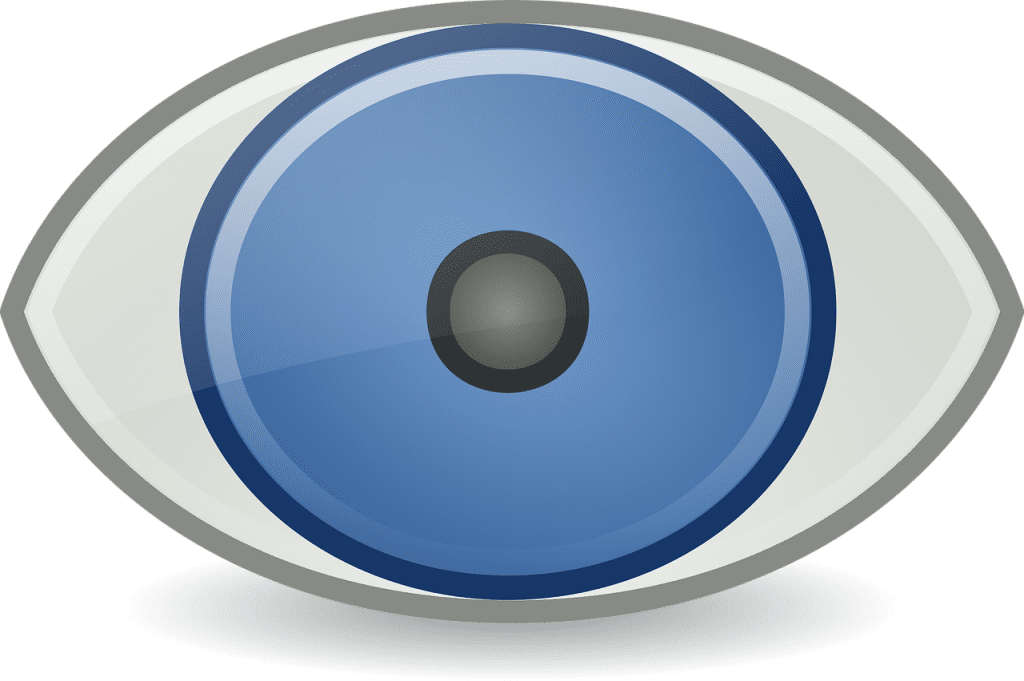
Transparenz in Gefahr?
Das Informationsfreiheitsgesetz zwischen Aufklärung und Abschaffung
In einer demokratischen Gesellschaft ist es essenziell, dass Bürgerinnen und Bürger nachvollziehen können, wie staatliches Handeln zustande kommt. Ein zentrales Instrument für diese Transparenz ist das Informationsfreiheitsgesetz (IFG). Es erlaubt es jeder Person – unabhängig von einem rechtlichen oder persönlichen Interesse –, Einsicht in amtliche Dokumente von Bundesbehörden zu nehmen. Doch dieses Gesetz steht derzeit unter Beschuss. Während es in der Vergangenheit brisante Skandale aufgedeckt hat, gibt es aktuell politische Kräfte, die es deutlich einschränken oder gar abschaffen wollen. Ein genauer Blick lohnt sich – auch, um die Tragweite einer möglichen Reform zu verstehen.
Was ist das Informationsfreiheitsgesetz?
Das IFG trat 2006 in Kraft und ist ein Element in der Entwicklung staatlicher Transparenz in Deutschland. Es räumt jeder natürlichen oder juristischen Person das Recht ein, bei Bundesbehörden Informationen anzufordern, ohne ein besonderes rechtliches Interesse nachweisen zu müssen. Ausgenommen sind nur bestimmte sicherheitsrelevante, personenbezogene oder betriebsgeheime Informationen.
Im internationalen Vergleich ist das deutsche IFG eher zurückhaltend ausgestaltet. In skandinavischen Ländern oder den USA sind solche Regelungen deutlich umfassender und älter. Dennoch stellt das IFG auch hierzulande ein zentrales Werkzeug für investigative Journalist:innen, NGOs und engagierte Bürger:innen dar.
Was konnte durch das IFG aufgedeckt werden?
Trotz mancher Hürden – etwa langer Bearbeitungszeiten oder restriktiver Ausnahmetatbestände – konnten durch IFG-Anfragen in den letzten Jahren mehrere politische und wirtschaftliche Skandale ans Licht gebracht werden:
1. Die Guttenberg-Affäre
Die Enthüllung, dass Karl-Theodor zu Guttenberg weite Teile seiner Dissertation plagiiert hatte, wurde durch investigative Recherche möglich – unterstützt durch Anträge auf Akteneinsicht. Auch die Promotionsunterlagen weiterer Politiker:innen wie Franziska Giffey wurden später öffentlich hinterfragt.
2. Maskendeals während der Pandemie
Während der Corona-Krise beschaffte das Bundesgesundheitsministerium unter Jens Spahn in großem Stil Masken – teils zu überhöhten Preisen, teils unter fragwürdigen Bedingungen. IFG-Anfragen führten zur Offenlegung interner E-Mails und Verträge, die Vetternwirtschaft und Intransparenz belegten.
3. PKW-Maut und Scheuers Millionendesaster
Der Versuch von Verkehrsminister Andreas Scheuer, eine PKW-Maut einzuführen, endete in einem verfassungswidrigen Vorhaben, das den Steuerzahler hunderte Millionen kostete. Interne Vermerke und Vertragsdetails, die durch das IFG zugänglich gemacht wurden, offenbarten erhebliche Verfahrensfehler.
4. Lobbyismus in Ministerien
Verschiedene Anfragen nach dem IFG beförderten ans Licht, wie Lobbygruppen in Gesetzgebungsprozesse eingebunden wurden. Unterlagen etwa zum Einfluss der Autoindustrie auf Umweltstandards belegen die strukturelle Nähe zwischen Wirtschaft und Politik.
Wer will das Gesetz einschränken oder abschaffen?
Besonders in den letzten Monaten ist das IFG in das Visier der Union geraten. Während der Debatten um eine Verwaltungsreform wurde im Kontext der CDU/CSU-Arbeitsgruppe unter Philipp Amthor öffentlich diskutiert, ob das IFG abgeschafft oder zumindest stark reformiert werden sollte.
Amthor sprach davon, das Gesetz „nicht ersatzlos“ streichen zu wollen – Ziel sei es, die Verwaltung von Anfragen zu entlasten und eine „effizientere“ Form der Informationsvermittlung zu schaffen. Allerdings wurde in internen Papieren laut Medienberichten durchaus eine komplette Abschaffung des IFG in Betracht gezogen.
Auch Vertreter der CSU äußerten sich kritisch. Das Gesetz werde teils „missbraucht“, hieß es, um Behörden mit Anfragen zu „blockieren“. Die Argumentation lautet: IFG-Anfragen seien teuer, personalintensiv und würden oft ohne tatsächliches öffentliches Interesse gestellt.
Kritik aus Zivilgesellschaft und Medien
Die Reaktion auf diese Vorschläge ließ nicht lange auf sich warten. Journalistenverbände, Transparenzinitiativen und zivilgesellschaftliche Organisationen wie FragDenStaat oder LobbyControl warnen eindringlich vor einer Aushöhlung oder Abschaffung des Gesetzes.
Der Deutsche Journalisten-Verband (DJV) erklärte, dass eine Einschränkung des IFG einem Angriff auf die Pressefreiheit gleichkomme. Gerade in Zeiten politischer Polarisierung und wachsender Staatsverdrossenheit sei staatliche Transparenz wichtiger denn je.
Auch international würde Deutschland mit einer Abschaffung des IFG ein schlechtes Signal senden. Schon heute liegt die Bundesrepublik im internationalen Ranking von Transparenzgesetzen auf einem mittleren Platz – Tendenz fallend.
Das IFG ist ein Kontrollinstrument der Macht?
Das Informationsfreiheitsgesetz ist kein bloßes Verwaltungsinstrument – es ist ein Werkzeug zur Kontrolle der Macht. In einer Zeit, in der politische Entscheidungen immer komplexer, undurchsichtiger und von wirtschaftlichen Interessen geprägt sind, brauchen Demokratien mehr Transparenz, nicht weniger.
Eine Abschaffung oder Schwächung des IFG würde nicht Bürokratie abbauen, sondern Kontrolle verhindern. Wer die öffentliche Nachvollziehbarkeit von Regierungshandeln einschränkt, stärkt letztlich Misstrauen und Verschwörungsdenken. Daher muss jeder Versuch, das IFG zu beschneiden, erschrecken und zurückgewiesen werden – von Medien, Juristen und einer wachsamen Öffentlichkeit.
Weiterführende Links:
