WHO ruft zum Kampf gegen Desinformation auf und damit zur Zensur?
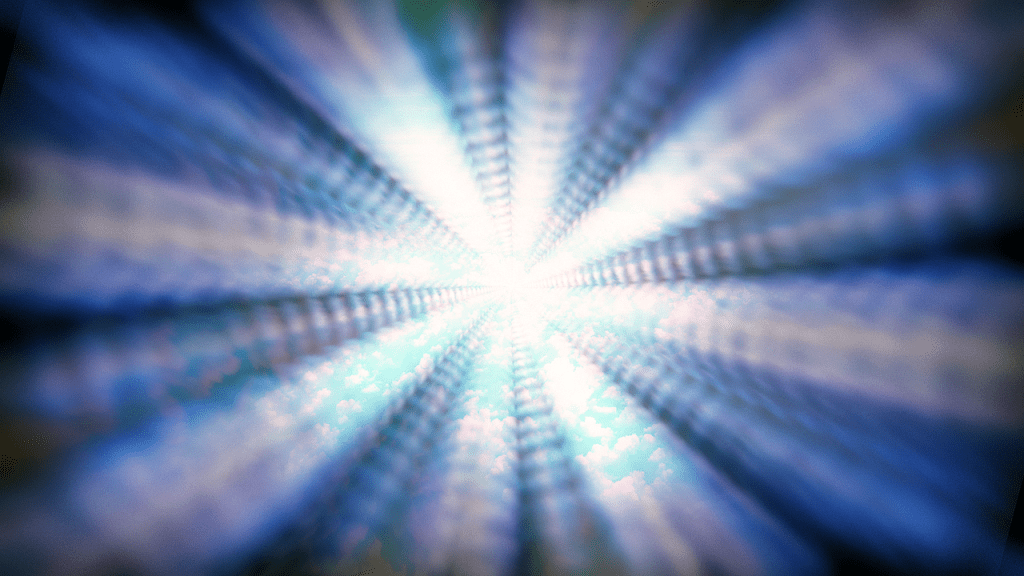
Dazu ein Beitrag in der NZZ: Die Stunde der Pandemie-Zensoren: Deutschland droht eine weitere Einschränkung der Meinungsfreiheit – 9.9.2025
Kernaussage des NZZ-Artikels (kompakt)
-
Deutschland bringe (so der Text) einen Gesetzentwurf voran, der WHO-Vorgaben aus der Pandemie-Zeit aufgreift und die Mitgliedstaaten verpflichte, „Kernkapazitäten für den Umgang mit Fehl- und Desinformation“ vorzuhalten. Das sei ein „Maulkorb“, weil unklar bleibe, was „Desinformation“ sei; dadurch drohe eine Kollision mit Art. 5 GG (Meinungsfreiheit).
-
Der Beitrag verweist auf frühere kontroverse Regierungs- und Expertenaussagen (Impfnebenwirkungen, Ansteckung Geimpfter, Laborhypothese, No-Covid) und warnt vor einem „Wahrheitsministerium“.
-
Zusätzlich wird auf WHO-Initiativen zur „Infodemie-Bekämpfung“ (Infodemic-Manager, Journalisten-Briefings) verwiesen, die als Indiz für eine institutionalisierte Wahrheitskontrolle gelesen werden.
Was der deutsche Gesetzentwurf tatsächlich enthält
-
Am 16. Juli 2025 hat das Bundeskabinett den Entwurf eines Vertragsgesetzes zur Umsetzung der am 1. Juni 2024 beschlossenen Änderungen der Internationalen Gesundheitsvorschriften (IHR/IGV) beschlossen. Die Begründung und der Text (inkl. amtlicher Übersetzung) sind veröffentlicht. (BMG)
-
In Anlage 1 IGV wird unter den „Kernkapazitäten“ ausdrücklich genannt: „Risikokommunikation, einschließlich des Umgangs mit Fehl- und Desinformation“ – auf kommunaler, mittlerer und nationaler Ebene. Es handelt sich um Pflichten zum Vorhalten/Entwickeln von Kapazitäten, nicht um ein unmittelbares Zensurregime.
-
Der Gesetzentwurf listet eingeschränkte Grundrechte auf (Art. 2 II S. 1, Art. 2 II S. 2, Art. 10, Art. 11 I GG). Art. 5 GG wird nicht aufgeführt. Das spricht dafür, dass der Bund selbst keine ausdrücklichen Eingriffe in die Meinungsfreiheit normiert, sondern die IGV-Änderungen als organisatorische/koordinative Pflichten versteht.
Internationale Einordnung
-
WHO betreibt seit 2020/22 Programme zum „Infodemic Management“ (u. a. Trainings, Community of Practice). Das belegt die existierende Governance-Linie, nicht aber nationale Zensurvorgaben. (Weltgesundheitsorganisation)
-
Schweiz: Der Bundesrat genehmigte die IHR-Änderungen am 20. Juni 2025, brachte aber einen Vorbehalt zu Maßnahmen gegen (Des-)Information in der Risikokommunikation an. Das zeigt, dass Staaten hier reservieren/konkretisieren können. (Admin News)
Verfassungsrechtliche Einordnung
I. Gegenstand
Die Bundesregierung hat mit Kabinettsbeschluss vom 16. Juli 2025 den Entwurf eines Vertragsgesetzes zur Zustimmung zu den Änderungen der Internationalen Gesundheitsvorschriften (IGV, „IHR amendments“) vorgelegt. Kern der Debatte ist die in Anlage 1 IGV verankerte Pflicht der Mitgliedstaaten, „Risikokommunikation einschließlich des Umgangs mit Fehl- und Desinformation“ vorzuhalten.
Strittig ist, ob diese Verpflichtung mit der Meinungsfreiheit nach Art. 5 GG sowie der Informations- und Meinungsfreiheit nach Art. 11 GRCh vereinbar ist.
II. Maßgebliche Normen
-
Grundgesetz
-
Art. 5 Abs. 1 S. 1 GG: Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten; Recht, sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten.
-
Art. 5 Abs. 2 GG: Schranken: allgemeine Gesetze, Bestimmungen zum Schutz der Jugend, Recht der persönlichen Ehre.
-
Art. 5 Abs. 1 S. 3 GG: Verbot der Zensur (präventives Verbot von Vorabkontrollen).
-
Grundrechte-Charta der Europäischen Union (GRCh)
-
Art. 11 Abs. 1 GRCh: Meinungsfreiheit, Informationsfreiheit.
-
Art. 11 Abs. 2 GRCh: Freiheit und Pluralismus der Medien.
-
Art. 52 Abs. 1 GRCh: Einschränkungen müssen gesetzlich vorgesehen, dem Wesensgehalt des Rechts angemessen und verhältnismäßig sein.
-
Völkerrechtlicher Hintergrund
-
IGV 2005, geändert 2024, beschlossen durch die WHO-Generalversammlung; Umsetzung in nationales Recht durch Vertragsgesetz.
III. Schutzbereich
Sowohl Art. 5 GG als auch Art. 11 GRCh erfassen jede Meinungsäußerung, unabhängig von Richtigkeit oder Qualität. Geschützt sind damit auch irrtümliche, provokante oder wissenschaftlich widerlegte Aussagen. Eingriffe können bereits in staatlichen Informationskontrollstrukturen liegen, wenn diese abschreckende Wirkung („chilling effect“) auf öffentliche Debatten entfalten.
IV. Eingriffsqualität der IGV-Regelung
-
Unmittelbarer Eingriff?
Der deutsche Gesetzentwurf normiert keine unmittelbare Einschränkung der Meinungsfreiheit. Art. 5 GG wird im Entwurf ausdrücklich nicht als eingeschränktes Grundrecht aufgeführt. Verpflichtet wird der Staat lediglich zur Vorhaltung von Kapazitäten im Bereich Risikokommunikation. -
Mittelbarer Eingriff?
-
Kritisch ist, dass die Begriffe „Fehl- und Desinformation“ vage bleiben. Ohne gesetzliche Konkretisierung droht ein unbestimmter Anwendungsbereich, der faktisch zu Einschüchterung oder staatlich gelenkter Informationshierarchie führen kann.
-
Werden staatliche Stellen befugt, Inhalte als „Desinformation“ zu klassifizieren und entsprechend zu entfernen oder zu sanktionieren, liegt ein klassischer Grundrechtseingriff vor.
V. Verfassungsrechtliche Maßstäbe
-
Bestimmtheitsgebot (Art. 20 Abs. 3 GG)
Eine Einschränkung muss klar abgrenzbar sein. Der pauschale Begriff „Desinformation“ genügt nicht. -
Verhältnismäßigkeit
-
Legitimer Zweck: Gesundheitsschutz, Schutz vor Gefahren durch Fehlinformation.
-
Eignung: Monitoring, Aufklärung, staatliche Gegenrede sind geeignet.
-
Erforderlichkeit: Maßnahmen, die weniger eingriffsintensiv sind (z. B. Informationskampagnen), sind vorrangig.
-
Angemessenheit: Sanktionen gegen Meinungsäußerungen dürfen nur bei nachweisbarer Gefährdung erheblicher Rechtsgüter zulässig sein.
-
Zensurverbot (Art. 5 Abs. 1 S. 3 GG)
Eine präventive Inhaltskontrolle (Genehmigungspflicht, Vorabfilter) wäre verfassungswidrig. -
Lüth-Formel (BVerfGE 7, 198)
Meinungsfreiheit ist „konstituierend für die freiheitlich-demokratische Grundordnung“. Einschränkungen dürfen nicht den öffentlichen Meinungskampf verengen, sondern müssen ihn offen halten.
VI. Einordnung nach der GRCh
-
Art. 11 GRCh verlangt zusätzlich die Medienpluralität. Staatliche Maßnahmen dürfen nicht dazu führen, dass kritische Stimmen strukturell benachteiligt oder einseitig delegitimiert werden.
-
Art. 52 GRCh: Jede Beschränkung muss gesetzlich präzise normiert und verhältnismäßig sein. Weite Blankettermächtigungen („Desinformation“) wären unvereinbar.
-
Der Digital Services Act (DSA) setzt unionsrechtlich bereits Rahmenbedingungen für Plattformen; weitergehende nationale Eingriffe müssen sich daran messen lassen und grundrechtskonform bleiben.
VII. Ergebnis
-
Der derzeitige deutsche Gesetzentwurf kollidiert noch nicht unmittelbar mit Art. 5 GG oder Art. 11 GRCh, da er lediglich Kapazitäten vorsieht.
-
Verfassungsrechtliche Risiken entstehen jedoch bei der Ausgestaltung:
-
Wird „Desinformation“ nicht präzise definiert, droht ein Verstoß gegen das Bestimmtheitsgebot.
-
Werden staatliche Stellen mit präventiven Kontroll- oder Löschbefugnissen ausgestattet, wäre dies unvereinbar mit dem Zensurverbot.
-
Werden abweichende wissenschaftliche Minderheitspositionen sanktioniert, würde dies die offene Wissenschafts- und Meinungsfreiheit verletzen.
-
VIII. Verfassungskonforme Umsetzung
-
Legaldefinition: „Fehlinformation“ darf nur solche Tatsachenbehauptungen erfassen, die objektiv falsch sind und unmittelbar erhebliche Gesundheitsgefahren hervorrufen. Werturteile und wissenschaftliche Hypothesen sind ausgenommen.
-
Instrumente: Vorrangig staatliche Gegenrede, Aufklärung, Transparenz; keine präventiven Sperren.
-
Verfahren: Klare Zuständigkeit, Dokumentationspflichten, gerichtlicher Rechtsschutz bei Klassifizierung als „Desinformation“.
-
EU-Kompatibilität: Enge Anbindung an den DSA, keine weitergehende Beschränkung ohne ausdrückliche Rechtfertigung.
-
Vorbehaltserklärung: Deutschland könnte – wie die Schweiz – eine völkerrechtliche Erklärung abgeben, wonach der IGV-Passus zur Desinformation nur im Rahmen der nationalen Verfassung umgesetzt wird.
Die Umsetzung der IGV-Änderungen ist grundsätzlich verfassungskonform möglich. Eine unpräzise oder sanktionsorientierte Auslegung würde jedoch einen erheblichen Konflikt mit Art. 5 GG und Art. 11 GRCh heraufbeschwören. Die Bundesregierung ist verpflichtet, die Meinungsfreiheit als tragende Säule der Demokratie zu wahren und darf die Pflicht zur „Desinformationsbekämpfung“ nur als Aufgabe der Aufklärung und Transparenz verstehen.
