GO-SH: Abwahl eines Bürgermeisters – Teil 9
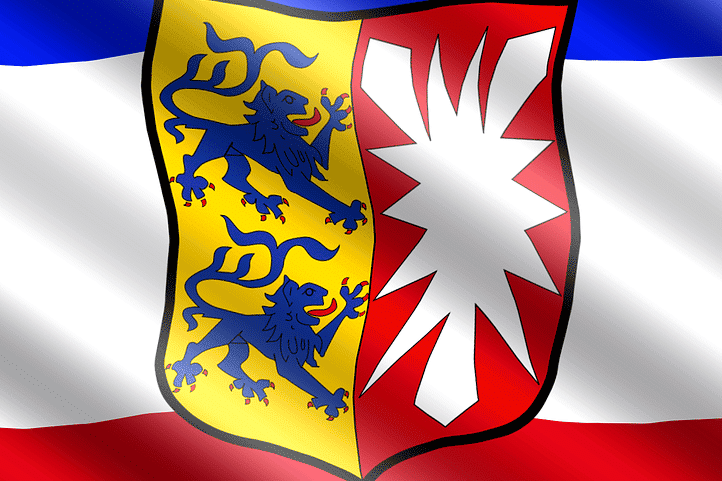
§ 188 StGB im kommunalen Anwendungsbereich und die Abwahl eines Bürgermeisters
Aktuell – NZZ:
Sieben Monate Haft auf Bewährung für Publizisten, weil er in einem satirischen Post die deutsche Innenministerin angriff
Der Chef des rechten «Deutschland-Kuriers» verbreitete ein manipuliertes Bild, auf dem Nancy Faeser ein Schild mit der Aufschrift «Ich hasse die Meinungsfreiheit» hält. Das soll strafbar sein.
In Schleswig-Holstein zeigen Beispiele wie Wedel und Ratzeburg, dass ehrverletzende öffentliche Vorwürfe – selbst wenn sie später strafrechtlich nicht verfolgt werden – erhebliche politische Folgen entfalten können. In beiden Städten trugen entsprechende Vorwürfe in sozialen Medien und lokaler Presse zur nachhaltigen Vertrauenserosion gegenüber amtierenden Bürgermeistern bei und beeinflussten maßgeblich den öffentlichen Diskurs vor deren Abwahl oder Rücktritt.
Dies unterstreicht, dass auch kommunale Amtsträger faktisch einem erheblichen Reputationsrisiko ausgesetzt sind – mit konkretem Einfluss auf den politischen Mandatsverlust. Derartige Konstellationen belegen, dass Äußerungen durchaus geeignet sein können, das öffentliche Wirken erheblich zu erschweren, und damit den Anwendungsbereich des § 188 StGB im Kontext der Abwahl eines Bürgermeisters grundsätzlich eröffnen sollten.
Die Staatsanwaltschaft Itzehoe erließ jedoch betreffend § 188 StGB u.a.
3 Einstellungsverfügungen
1. Verfahren gegen X (Az. 321 Js 17185/24)
Tatvorwurf:
Üble Nachrede und Verleumdung gegen eine Person des politischen Lebens (damals Bürgermeister einer schleswig-holsteinischen Stadt) durch Facebook-Postings.
Entscheidung:
Die Staatsanwaltschaft sah von der Erhebung der öffentlichen Klage ab (§ 376 StPO) mit der Begründung, dass kein öffentliches Interesse an der Strafverfolgung bestehe. Ein hinreichender Tatverdacht nach § 188 StGB wurde verneint, da die Äußerungen – überwiegend als Meinungsäußerungen qualifiziert – nicht geeignet seien, das öffentliche Wirken des Betroffenen „erheblich zu erschweren“.
Zudem sei eine Störung des Rechtsfriedens lediglich auf den individuellen Lebenskreis des Geschädigten beschränkt. Zwar hätten die Äußerungen auf Facebook stattgefunden, jedoch sei dies vor dem Hintergrund der öffentlichen Rolle des Anzeigenden (kommunale Amtsführung) nicht ausreichend für eine Annahme allgemeinen Interesses.
Hinweis:
Die Staatsanwaltschaft empfahl den Weg der Privatklage nach § 374 StPO.
2. Verfahren gegen Y (Az. 321 Js 16576/24)
Tatvorwurf:
Verleumdung und üble Nachrede durch eine auf Facebook veröffentlichte Behauptung, der Betroffene habe „einem Kumpel tausende Euro aus der städtischen Kasse zugeschoben“.
Entscheidung:
Die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens wurde mangels Anfangsverdachts (§ 152 Abs. 2 StPO) abgelehnt.
Die Staatsanwaltschaft stellte fest, dass die Aussage durch § 193 StGB gedeckt sei (Wahrnehmung berechtigter Interessen). Es habe sich um eine politische Meinungsäußerung im Rahmen eines gesellschaftlichen Diskurses gehandelt, wobei die Vorwürfe zum Zeitpunkt der Äußerung bereits öffentlich und pressebekannt waren. Eine Schmähkritik oder bewusste Falschbehauptung sei nicht feststellbar.
Auch hier wurde § 188 StGB als nicht einschlägig angesehen, da die Äußerung nicht geeignet sei, das öffentliche Wirken des Betroffenen erheblich zu erschweren.
3. Verfahren gegen Z (Az. 321 Js 22045/24)
Tatvorwurf:
Verleumdung und üble Nachrede durch eine auf Facebook veröffentlichte Behauptungen und Anspielungen auf die Herkunft des Betroffenen.
Entscheidung:
Die vom Beschuldigten öffentlich gemachten Äußerungen über den Mandanten Z erreichen weder den objektiven Tatbestand der Beleidigung (§ 185 StGB), noch denjenigen der üblen Nachrede (§ 186 StGB) oder der Verleumdung (§ 187 StGB). Die Grenze zur strafbaren Schmähkritik sei nicht überschritten worden.
Die Staatsanwaltschaft verweist auf den verfassungsrechtlich geschützten Vorrang der Meinungsfreiheit (Art. 5 Abs. 1 GG), insbesondere im Kontext gesellschaftspolitischer Debatten. Abwertende oder zugespitzt formulierte Äußerungen seien im Rahmen des öffentlichen Meinungskampfes grundsätzlich hinzunehmen, sofern sie nicht allein auf die Diffamierung der betroffenen Person abzielen. Auch sei zu berücksichtigen, dass der Sachverhalt bereits zuvor Gegenstand der medialen Berichterstattung war.
Des Weiteren liege auch keine Volksverhetzung (§ 130 StGB) vor. Die im beanstandeten Artikel enthaltenen Hinweise auf die staatsbürgerliche Herkunft des Betroffenen erfüllten nicht die Voraussetzungen dieser Norm, da weder zu Hass aufgestachelt noch zur Gewalt aufgerufen wurde, noch eine böswillige Verächtlichmachung erkennbar sei.
§ 188 StGB wurde als nicht einschlägig angesehen, da die Äußerung nicht geeignet sei, das öffentliche Wirken des Betroffenen erheblich zu erschweren.
Aber: Die Abwahl eines Bürgermeisters kann durch solche Vorwürfe maßgeblich beeinflusst werden, was die Bedeutung des § 188 StGB in politischen Auseinandersetzungen unterstreicht.
Ein Blick auf die Bundes- und Landespolitik:
Im Jahr 2024 haben mehrere deutsche Politiker Strafanzeigen gemäß § 188 StGB (Beleidigung, üble Nachrede und Verleumdung gegen Personen des politischen Lebens) gestellt. Besonders hervorzuheben ist Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck, der 2024 insgesamt 1.372 Strafanzeigen wegen Anfeindungen gegen seine Person erstattete. Außenministerin Annalena Baerbock folgte mit 513 Anzeigen
In Mecklenburg-Vorpommern wurden zwischen 2022 und 2024 etwa 90 Strafanzeigen von Mitgliedern der Landesregierung wegen Beleidigung oder übler Nachrede gestellt, darunter drei Fälle speziell aufgrund von § 188 StGB.
Detaillierte Statistiken über die Anzahl der von der Staatsanwaltschaft aufgenommenen, eingestellten oder weiterverfolgten Verfahren im Zusammenhang mit § 188 StGB sind öffentlich nicht umfassend verfügbar. Allerdings gab es einige bemerkenswerte Fälle:
- Bezeichnung von Olaf Scholz als „Volksschädling“: Ein Demonstrant bezeichnete Bundeskanzler Olaf Scholz als „Volksschädling“. Das Bayerische Oberste Landesgericht entschied, dass diese Äußerung nicht strafbar sei.
- Beleidigung von Bundeskanzlerin Angela Merkel: Ein Facebook-Nutzer bezeichnete die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel im Jahr 2021 öffentlich als „dumme Schlampe“. Das Oberlandesgericht Zweibrücken entschied im September 2024, dass für eine Strafbarkeit nach § 188 StGB die Reichweite der Beleidigung unerheblich sei, und verurteilte den Nutzer entsprechend.
- Strafanzeige gegen einen Rentner wegen Beleidigung von Robert Habeck: Ein Rentner bezeichnete Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck auf der Plattform X als „Schwachkopf“. Daraufhin erstattete Habeck Anzeige wegen Beleidigung, was zu einer Hausdurchsuchung beim Rentner führte. Dieser Vorfall löste eine öffentliche Debatte über die Verhältnismäßigkeit solcher Maßnahmen aus.
Bedarf es einer rechtspolitischen Reform des § 188 StGB, damit auch Kommunalpolitiker ausreichend geschützt sind?
Die jüngsten Einstellungsverfügungen der Staatsanwaltschaft Itzehoe in zwei Verfahren belegen eine restriktive Auslegung und Anwendung des § 188 StGB (Beleidigung, üble Nachrede oder Verleumdung gegen Personen des politischen Lebens). Dies steht in einem Spannungsverhältnis zu dem in § 188 StGB intendierten Schutzzweck, nämlich den politischen Diskurs vor gezielter Verunglimpfung zu schützen und die Integrität politischer Amtsführung zu wahren.
- Gesetzestext: § 188 StGB schützt Personen des politischen Lebens bei ehrverletzenden Tathandlungen dann strafschärfend, wenn die Tathandlung geeignet ist, das öffentliche Wirken erheblich zu erschweren.
- Anwendungspraxis: Die Rechtspraxis beschränkt den Anwendungsbereich auf Fälle:
- von erheblicher medialer Reichweite,
- mit neuartigem, nicht bereits öffentlich diskutiertem Inhalt,
- bei bundespolitischer Prominenz.
Kommunale Mandatsträger werden demgegenüber faktisch vom Anwendungsbereich ausgeschlossen, was verfassungsrechtliche Gleichheitsbedenken aufwerfen kann.
Dogmatische Defizite
- Unklare Bestimmung des Begriffs „öffentliches Wirken“:
- Die Auslegung ist inkonsistent; es fehlt eine einheitliche Definition.
- Kommunalpolitiker sind rechtlich und funktional Träger öffentlicher Gewalt, werden aber nicht gleichwertig geschützt.
- Unklarer Maßstab der „Erheblichkeit“:
- Die Erheblichkeitsschwelle führt faktisch zu einer Überbetonung der Meinungsfreiheit zulasten des Ehrschutzes.
- Ungleichbehandlung bei öffentlichem Interesse:
- 376 StPO wird restriktiv ausgelegt, ohne objektivierbare Kriterien.
§ 376 StPO Anklageerhebung bei Privatklagedelikten:
„Die öffentliche Klage wird wegen der in § 374 bezeichneten Straftaten von der Staatsanwaltschaft nur dann erhoben, wenn dies im öffentlichen Interesse liegt.“
- 376 StPO wird restriktiv ausgelegt, ohne objektivierbare Kriterien.
Reformvorschläge
- Klarstellung in § 188 Abs. 1 StGB:
- Einfügung eines Klammerzusatzes: „… wenn die Tathandlung geeignet ist, das öffentliche Wirken (auch auf kommunaler oder sonstiger funktionaler Ebene) erheblich zu erschweren.“
- Definition des öffentlichen Wirkens (Abs. 3 neu):
- „Öffentliches Wirken im Sinne dieses Gesetzes umfasst jedes Amts- oder Mandatshandeln, das auf der Grundlage demokratischer Legitimation erfolgt, unabhängig von der Ebene der Ausübung.“
- Umkehrung des Regel-Ausnahme-Verhältnisses bei § 376 StPO in Fällen des § 188 StGB:
- „Das öffentliche Interesse ist bei Amtsträgern grundsätzlich zu bejahen, sofern keine besonderen Umstände entgegenstehen.“
Bewertung im Lichte der Grundrechte
Die vorgeschlagenen Ergänzungen achten die Meinungsfreiheit (Art. 5 GG), da sie die Hürde der „Erheblichkeit“ beibehalten, aber einer selektiven Anwendung entgegenwirken. Der demokratische Diskurs wird nicht unterdrückt, sondern durch fairen und rechtstreuen Umgang mit politischen Amtsträgern gestärkt.
Die Praxis zeigt ein Vollzugsdefizit des § 188 StGB bei kommunalen Mandatsträgern. Die vorgeschlagene Reform würde zur Vereinheitlichung der Anwendung, zur Stärkung des Ehrschutzes und zur verfassungsrechtlich gebotenen Gleichbehandlung beitragen.
