Trusted Flagger – private Überwachung für den Staat?
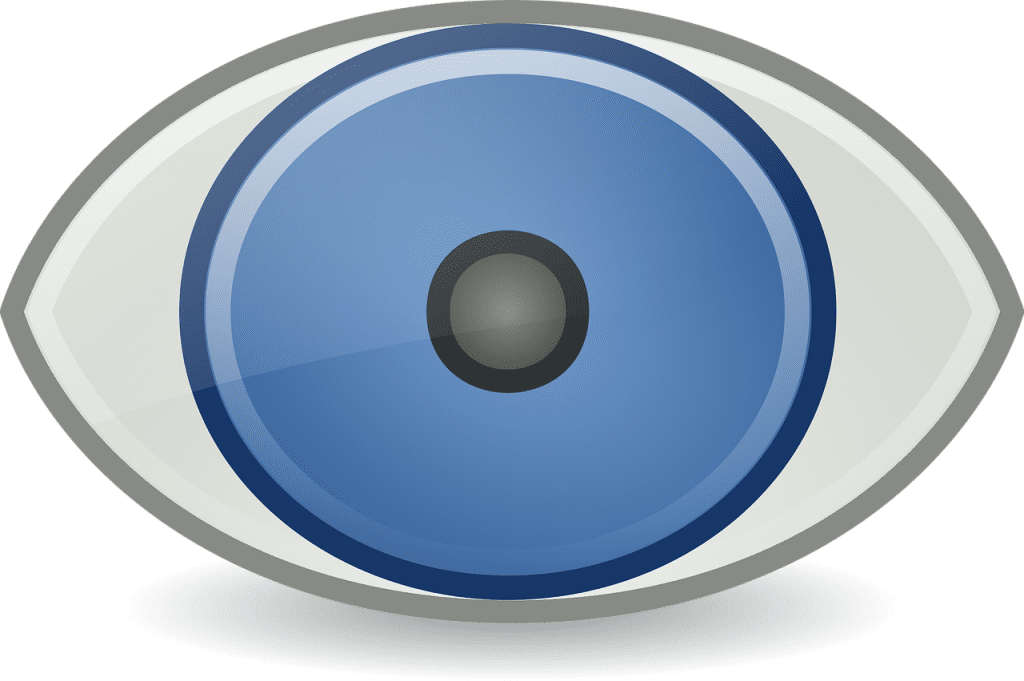
Am 8.10.2024 veröffentlicht die NZZ folgenden Artikel:
«Trusted Flagger» durchsuchen das Internet im Auftrag der Bundesregierung nach unliebsamen Meinungen
Eigentlich sollen sie nur illegale Inhalte melden, doch die Bundesnetzagentur spricht auch von «Hass und Fake News», die leichter entfernt werden könnten. Juristen sehen die Meinungsfreiheit in Gefahr.
Als erster anerkannter Trusted Flagger in Deutschland wurde am 1. Oktober die Meldestelle Respect! der Stiftung zur Förderung der Jugend in Baden-Württemberg zugelassen. Diese «private» Meldestelle in Form einer Stiftung wird finanziert durch das von der Grünen Lisa Paus geführte Bundesfamilienministerium und andere staatliche Stellen aus Baden-Württemberg und Bayern.
In einem Kommentar schreibt die NZZ weiter:
Meldestellen, die unter dem Vorwand der vermeintlich wohlgesinnten Zivilgesellschaft gegen Äusserungen unterhalb der Strafbarkeitsgrenze vorgehen, sind nichts anderes staatlich geförderte Zensurapparate.
Meldeportale und «vertrauenswürdige Melder», egal wie blumig ihre Etiketten sein mögen, würden dieses Gefühl weiter befeuern. Eine Zeit, in der Privatmeinungen engmaschig überwacht und im Zweifel von anderen Privatpersonen gemeldet wurden, gab es schon einmal: Es war die Zeit des Überwachungsstaates DDR. Die Bundesregierung sollte deshalb von jeglichen privaten «Hinweisgebern» Abstand nehmen.
Was sind Trusted Flagger und auf welcher Rechtsgrundlage erteilt die Bundesnetzagentur Überwachungsgenehmigungen an private Initiativen und Vereine?
Flagger gemäß dem Digital Services Act (DSA) der EU sind Benutzer oder Organisationen, die als vertrauenswürdige Melder (Trusted Flaggers) fungieren. Sie sollen eine wichtige Rolle bei der Überwachung illegaler Inhalte auf Online-Plattformen spielen. Der DSA definiert bestimmte Kriterien, die eine Organisation erfüllen muss, um den Status eines vertrauenswürdigen Melders zu erlangen, wie z.B. Fachwissen, Unabhängigkeit und die Fähigkeit, Inhalte objektiv zu bewerten.
Wenn vertrauenswürdige Melder Inhalte melden, sind Online-Plattformen verpflichtet, diese Meldungen mit Vorrang und in beschleunigter Weise zu überprüfen und gegebenenfalls zu handeln. Der Status eines vertrauenswürdigen Melders wird von der jeweiligen nationalen Behörde verliehen und kann entzogen werden, wenn er missbräuchlich verwendet wird. Ziel dieser Regelung ist es, die Effizienz und Genauigkeit bei der Bekämpfung illegaler Inhalte im Internet zu verbessern.
Die Einführung von Trusted Flaggers unter dem Digital Services Act (DSA) der EU wird oft kontrovers diskutiert, und die Frage, ob es sich dabei um Zensur handelt, ist komplex. Der DSA soll den Umgang mit illegalen Inhalten auf Plattformen regeln, nicht jedoch rechtmäßige Inhalte beschränken. Plattformen werden dazu verpflichtet, gemeldete Inhalte schneller zu prüfen, wenn sie von vertrauenswürdigen Meldern stammen, aber sie sind nicht verpflichtet, diese Inhalte sofort zu entfernen.
Kritiker argumentieren, dass die Möglichkeit zur schnellen Meldung und Bearbeitung von Inhalten durch vertrauenswürdige Melder das Risiko von Zensur erhöhen könnte, insbesondere wenn diese Melder ihre Rolle missbrauchen oder voreingenommene Entscheidungen treffen. Befürchtet wird, dass auch rechtmäßige Inhalte übermäßig restriktiv behandelt werden könnten, was zu einem „Chilling Effect“ führen könnte – also einer Selbstzensur von Nutzern aus Angst, dass ihre Beiträge als problematisch angesehen werden könnten.
Befürworter hingegen betonen, dass der DSA klare Richtlinien und Mechanismen zur Überprüfung von Inhalten vorsieht und dass Plattformen dazu verpflichtet sind, transparente Berichte über ihre Moderationsentscheidungen zu erstellen. Der DSA legt zudem hohen Wert auf die Einhaltung der Grundrechte, einschließlich der Meinungsfreiheit, und bietet Möglichkeiten zur Anfechtung von Entscheidungen, die zur Entfernung von Inhalten führen.
Es hängt also stark davon ab, wie diese Regelungen umgesetzt werden und wie sorgfältig die Mechanismen zur Vermeidung von Missbrauch eingehalten werden.
Die Rolle der Trusted Flaggers (vertrauenswürdigen Melder) ist im Artikel 22 des Digital Services Act (DSA) der EU geregelt. Dieser Artikel definiert, wie eine Organisation den Status eines Trusted Flaggers erhalten kann, welche Pflichten damit verbunden sind und wie die Meldungen von solchen Flaggers durch Online-Plattformen behandelt werden sollen.
Einige wichtige Punkte aus Artikel 22 des DSA:
-
Kriterien für Trusted Flaggers: Eine Organisation kann den Status eines Trusted Flaggers erhalten, wenn sie bestimmte Kriterien erfüllt, darunter:
- Nachweisliches Fachwissen und Erfahrung bei der Bekämpfung illegaler Inhalte.
- Unabhängigkeit und Neutralität bei der Bewertung von Inhalten.
- Ein hohes Maß an Präzision und Sorgfalt in ihrer Arbeit.
-
Prioritäre Bearbeitung: Wenn ein Trusted Flagger Inhalte als illegal meldet, sind Plattformen verpflichtet, diese Meldungen bevorzugt zu bearbeiten. Das bedeutet, dass diese Meldungen schneller und mit höherer Priorität geprüft werden müssen als andere Meldungen.
-
Statusvergabe und Überwachung: Der Status eines Trusted Flaggers wird von den zuständigen nationalen Behörden verliehen und überwacht. Diese Behörden haben auch das Recht, den Status wieder zu entziehen, wenn Missbrauch festgestellt wird oder die Organisation die Anforderungen nicht mehr erfüllt.
-
Transparenz: Plattformen müssen Berichte über den Umgang mit Meldungen von Trusted Flaggers erstellen und öffentlich zugänglich machen. Dies dient dazu, Transparenz zu gewährleisten und sicherzustellen, dass Entscheidungen nachvollziehbar sind.
Die genaue Rolle und Verantwortung der Trusted Flaggers ist also eng mit der Verpflichtung verbunden, illegale Inhalte schnell und effektiv zu identifizieren und zu melden, während gleichzeitig Maßnahmen zur Verhinderung von Missbrauch und zum Schutz der Meinungsfreiheit bestehen.
Aber was sind Hass, Fake News oder Propaganda im Netz – definiert dies nicht jeder Staat anders und gestattet das GG im Rahmen der Meinungsfreiheit derartige Äußerungen, damit der Staat nicht zensieren kann?
Die Reichweite der Meinungsfreiheit variiert allein bereits innerhalb der EU und auch zwischen den Mitgliedstaaten, da sie unterschiedlichen rechtlichen und kulturellen Traditionen folgen. Diese Unterschiede erschweren es, einheitliche Definitionen für Begriffe wie „Hassrede“, „Fake News“ oder „illegale Inhalte“ im Rahmen des Digital Services Act (DSA) zu etablieren.
Der DSA selbst definiert diese Begriffe nicht explizit, sondern stützt sich auf die bereits bestehenden nationalen Gesetze und EU-Rechtsvorschriften. Dies bedeutet, dass Inhalte als illegal gelten, wenn sie nach den Gesetzen des jeweiligen Mitgliedstaats, in dem sie veröffentlicht wurden oder zugänglich sind, verboten sind. Die Umsetzung des DSA basiert also auf dem Prinzip, dass die Plattformen die Gesetze des Landes einhalten müssen, in dem die Inhalte abrufbar sind.
In Bezug auf „Hassrede“ und „Fake News“ orientiert sich der DSA an den Regelungen des EU-Rechts, insbesondere an der Richtlinie über audiovisuelle Mediendienste (AVMD-Richtlinie) und der Verordnung zur Bekämpfung der Verbreitung terroristischer Online-Inhalte. Die Definition von Hassrede wird oft anhand von Kriterien wie der Anstachelung zu Gewalt, Diskriminierung oder Feindseligkeit gegenüber bestimmten Gruppen festgelegt, wie sie auch in der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR) zu finden sind.
Was „Fake News“ betrifft, ist es noch komplizierter, da die Meinungsfreiheit auch das Recht umfasst, falsche oder irreführende Informationen zu verbreiten, solange sie nicht in eine Kategorie von illegalen Inhalten fällt (z.B. Betrug, Diffamierung oder Aufstachelung zu Gewalt). Der DSA zielt hier eher darauf ab, die Transparenz und den Umgang mit solchen Inhalten zu verbessern, indem Plattformen zu mehr Verantwortung und Offenlegung verpflichtet werden, wie sie mit Desinformation umgehen.
Die Herausforderung besteht also darin, ein Gleichgewicht zwischen dem Schutz der Meinungsfreiheit und der Bekämpfung illegaler Inhalte zu finden, ohne dabei in Zensur zu verfallen. Entscheidungen über die Einstufung und Entfernung von Inhalten sollten überprüfbar sein und die Möglichkeit bieten, gegen diese vorzugehen, um Missbrauch zu verhindern. Sie sollten aber in keinem Fall staatlich organisiert sein, finanziell vom Staat abhängig sein oder eine vorauseilende Beschränkung der Meinungsfreiheit darstellen, weil jeder jeden überwachen und melden kann.
Ob dabei ausgerechnet die Bundesnetzagentur als Regulierungsbehörde die Schlüsselposition für die Lizenzierung von Trusted Flaggern sein sollte, ist deutlich zu hinterfragen.
Aufgaben der Regulierungsbehörde Bundesnetzagentur:
Die Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen (BNetzA) ist eine deutsche Regulierungsbehörde, die dem Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz unterstellt ist. Sie hat vielfältige Zuständigkeiten in verschiedenen Bereichen, die darauf abzielen, den Wettbewerb zu fördern, den Zugang zu Märkten zu regulieren und die Infrastruktur in Deutschland zu sichern.
1. Elektrizität und Gas
- Netzzugang und Netzregulierung: Die BNetzA reguliert den Zugang zu den Strom- und Gasnetzen, um einen fairen Wettbewerb zu gewährleisten. Sie stellt sicher, dass alle Marktteilnehmer diskriminierungsfreien Zugang zu den Energienetzen haben.
- Tarifregulierung: Sie setzt die Netzentgelte fest, also die Gebühren, die Netzbetreiber für die Nutzung ihrer Netze erheben dürfen. Diese Entgelte sollen fair und kostendeckend sein.
- Versorgungssicherheit: Die Agentur überwacht die Stabilität und Sicherheit der Energieversorgung und entwickelt Konzepte, um eine zuverlässige und nachhaltige Energieversorgung zu gewährleisten.
2. Telekommunikation
- Regulierung des Marktes: Die BNetzA sorgt für fairen Wettbewerb auf dem Telekommunikationsmarkt, indem sie den Zugang zu Netzen und Diensten reguliert und Monopolstellungen abbaut.
- Frequenzverwaltung: Sie verwaltet die Vergabe und Nutzung von Funkfrequenzen, die z.B. für Mobilfunk, Rundfunk und andere drahtlose Kommunikation erforderlich sind.
- Verbraucherschutz: Die Agentur setzt Maßnahmen um, die den Schutz der Verbraucher in der Telekommunikation stärken, insbesondere bei Fragen zu Vertragsbedingungen, Netzneutralität und Rufnummernportabilität.
3. Postwesen
- Sicherung der Universaldienste: Die BNetzA überwacht, dass die Deutsche Post AG und andere Postdienstleister ihren Verpflichtungen zur flächendeckenden Bereitstellung von Postdienstleistungen nachkommen.
- Regulierung von Entgelten: Sie prüft und genehmigt die Preise für Brief- und Paketdienste, insbesondere wenn es um Dienstleistungen geht, die im Rahmen eines Monopols erbracht werden.
4. Eisenbahnverkehr
- Netzzugang: Die Bundesnetzagentur überwacht den diskriminierungsfreien Zugang zu den Eisenbahnnetzen und stellt sicher, dass alle Eisenbahnverkehrsunternehmen Zugang zu den Schienennetzen erhalten.
- Preiskontrolle: Sie prüft die Entgelte, die Betreiber von Schieneninfrastruktur für die Nutzung ihrer Netze erheben, und stellt sicher, dass diese fair und transparent sind.
- Schlichtung und Beschwerdemanagement: Bei Konflikten zwischen Eisenbahnunternehmen und Netzbetreibern bietet die BNetzA Schlichtungsverfahren an.
5. Verbraucherschutz
- Telekommunikation und Internet: Die BNetzA kümmert sich um Verbraucherbeschwerden zu Themen wie Rufnummernmissbrauch, unerlaubter Telefonwerbung und Problemen bei der Rufnummernmitnahme.
- Energie: Sie setzt sich für den Schutz der Endverbraucher auf dem Energiemarkt ein, zum Beispiel bei Problemen mit dem Anbieterwechsel oder unklaren Energieabrechnungen.
6. Smart-Metering und Digitalisierung
- Einführung intelligenter Messsysteme: Die Bundesnetzagentur fördert den Einsatz von intelligenten Stromzählern (Smart Meters) und anderen digitalen Technologien, um die Energiewende zu unterstützen.
- Cybersicherheit: Sie spielt eine Rolle bei der Sicherstellung der Cybersicherheit in den regulierten Infrastrukturbereichen und arbeitet an der Implementierung sicherer digitaler Systeme.
7. Schutz Kritischer Infrastrukturen
- Die BNetzA ist auch für die Sicherstellung der Stabilität und Sicherheit kritischer Infrastrukturen zuständig, wie z.B. der Energieversorgung und Kommunikationsnetze, insbesondere im Hinblick auf Ausfälle oder Cyberangriffe.
8. Schlichtungsstelle
- Die Bundesnetzagentur bietet Schlichtungsverfahren in den Bereichen Telekommunikation, Post und Eisenbahn an, um Streitigkeiten zwischen Verbrauchern und Unternehmen effizient und außergerichtlich zu klären.
Die Zuständigkeiten der Bundesnetzagentur sind breit gefächert und spielen eine zentrale Rolle bei der Sicherstellung eines funktionierenden, wettbewerbsfähigen und sicheren Infrastrukturmarktes in Deutschland.
